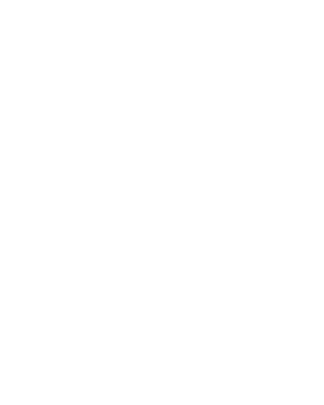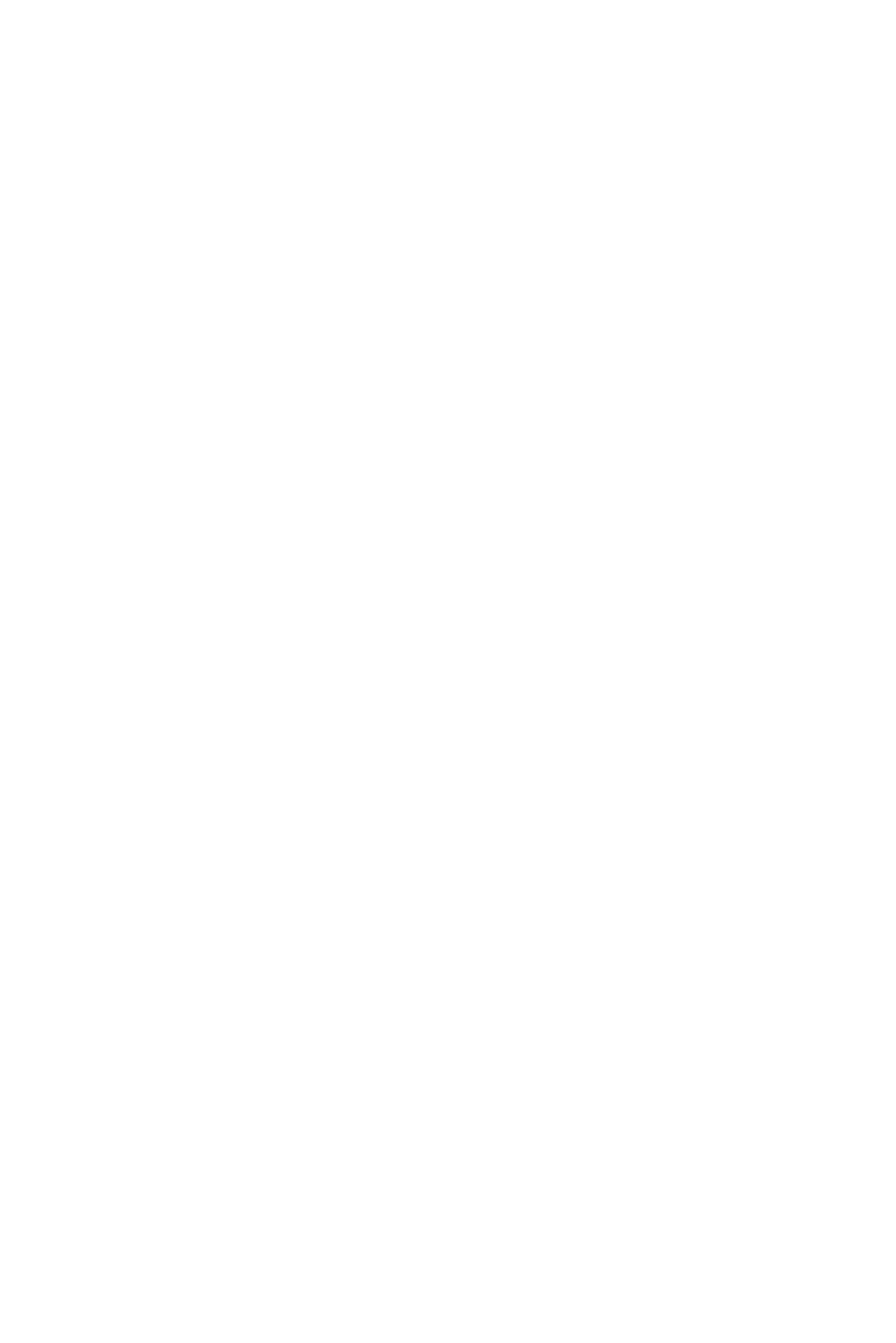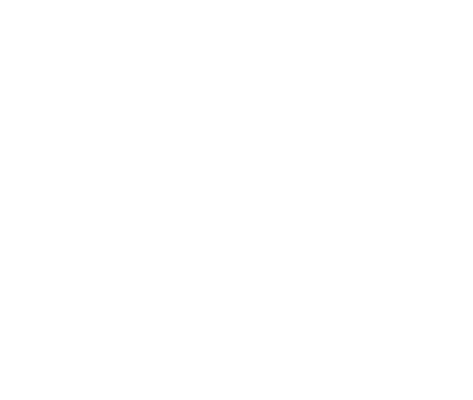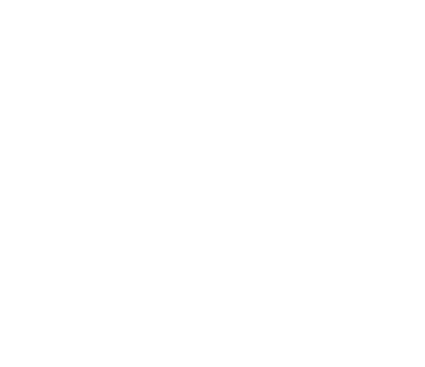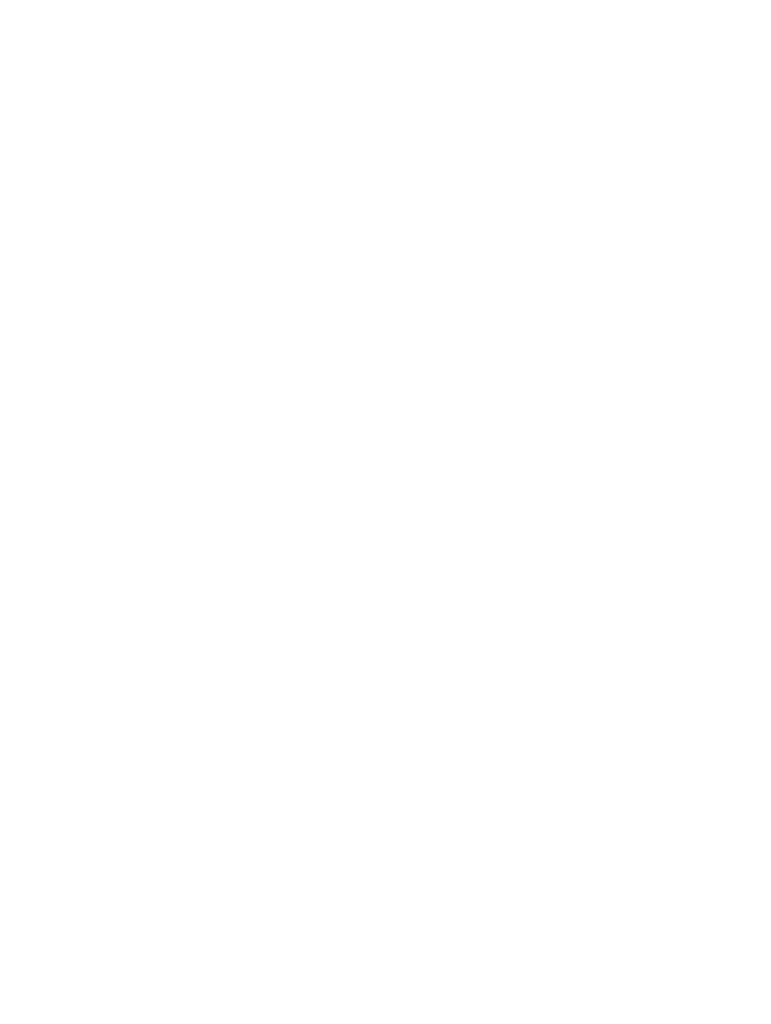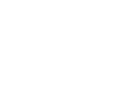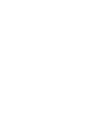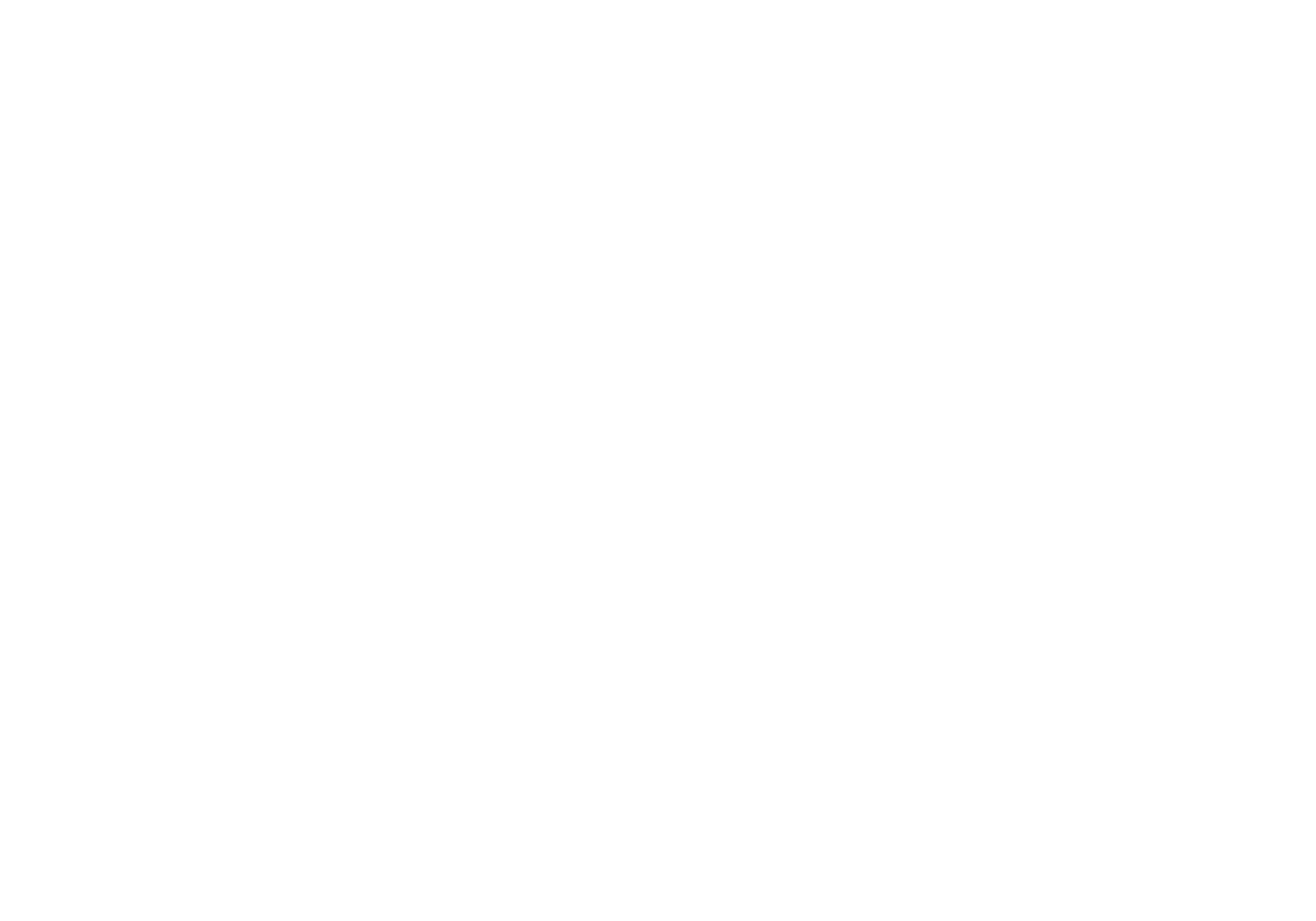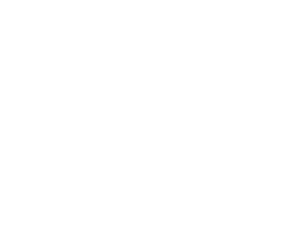© Jan Windszus Photography
Wie komponiert man einen Helden?
Über komische Ritter, trunkene Faune und abwesende Heroen – Eine Einführung zum Sinfoniekonzert Heldenträume.
von Wolfgang Behrens
von Wolfgang Behrens
Stellen wir uns eine Person vor, die gerne in die Kunst des guten Erzählens eingeführt werden möchte und deshalb zum Beispiel einen Kurs in Drehbuch-Schreiben besucht. Es ist gut möglich, dass unsere Person hier einige fast reißbrettartige Prinzipien an die Hand bekommt, die eine gute Erzählung ausmachen bzw. die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein größeres Publikum folgen kann, enorm steigern. Eine dieser Regeln wird lauten: Etabliere einen Helden (oder eine Heldin), mit dem (oder der) sich das Publikum identifizieren kann. Dazu muss diesem Helden (und wir meinen Heldinnen auch weiterhin mit) eine Welt gebaut werden, aus der er stammt und in der er wirkt. Der Held sollte möglichst auch eine gehörige Packung unverdientes Leid zu tragen haben, das verstärkt die Bereitschaft der Menschen, mit ihm mitzufühlen. Und der Held braucht eine Aufgabe, die er – natürlich erst nach einigen kleineren Kämpfen und Umwegen – am Ende der Erzählung bewältigt. Oder, wenn es ein tragisches Ende ist, vielleicht auch nicht. Am Ende des Kurses wird unsere Versuchsperson jedenfalls eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie sie so ein Drehbuch anpacken könnte. Und da dieser Kurs-Baukasten durchaus auf andere erzählerische Genres übertragbar ist, könnte sie sich auch an einer Novelle, einem Roman oder einem Theaterstück versuchen.
Heldenträume
Eine sinfonische Reise von Rom bis La Mancha
Richard Strauss [1864-1949]
Don Quixote, Phantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters für großes Orchester, op. 35
Claude Debussy [1862–1918]
Prélude à l’après-midi d’un faune
Ottorino Respighi [1879-1936]
Pini di Roma, Sinfonische Dichtung in vier Sätzen
Richard Strauss [1864-1949]
Don Quixote, Phantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters für großes Orchester, op. 35
Claude Debussy [1862–1918]
Prélude à l’après-midi d’un faune
Ottorino Respighi [1879-1936]
Pini di Roma, Sinfonische Dichtung in vier Sätzen
Nun ist Musik sicherlich kein erzählerisches Genre im engeren Sinne. Und doch könnte man sich fragen, ob unsere Kursteilnehmerin nicht auch einiges mitnehmen könnte, um etwa eine Sinfonie zu komponieren. Aber wer ist der Held einer Sinfonie? Das Hauptthema des ersten Satzes? Und wie könnte die Aufgabe aussehen, die dem Thema/Helden gestellt wird? Unverdientes Leid wird dem Thema wohl kaum aufzubürden sein. Obwohl: Es könnte ja als zerknirschtes, niedergedrücktes Moll-Thema starten und sich am Ende in jubilierendes Dur verwandeln. Je länger man darüber nachdenkt, desto mehr Möglichkeiten wird man entdecken, erzählerische Prinzipien auch in der Musik wirken zu lassen – selbst wenn die beschriebenen Reißbrettverfahren jeweils erheblichen Anpassungen unterworfen werden müssten. Zumindest aber nimmt es nicht wunder, dass irgendwann in der Musikgeschichte die Idee aufkam, Helden auch musikalisch zu formen, sie in eine bestimmte Welt und durch diverse Situationen zu schicken und sie am Ende triumphieren oder scheitern zu lassen. Und die musikalische Gattung, die nicht zuletzt zu diesem Zweck aus der Taufe gehoben wurde, trug denn auch den Verweis auf sprachlich verfasste Kunst bereits im Namen: Sinfonische Dichtung. Im heutigen Konzertprogramm, das uns mit und von musikalischen Helden träumen lässt, begegnen wir drei Sinfonischen Dichtungen, die zwar in dem musikgeschichtlich vergleichsweise kurzen Zeitraum von ungefähr dreißig Jahren entstanden, ihre Helden aber auf recht unterschiedliche Weise lebendig werden lassen.
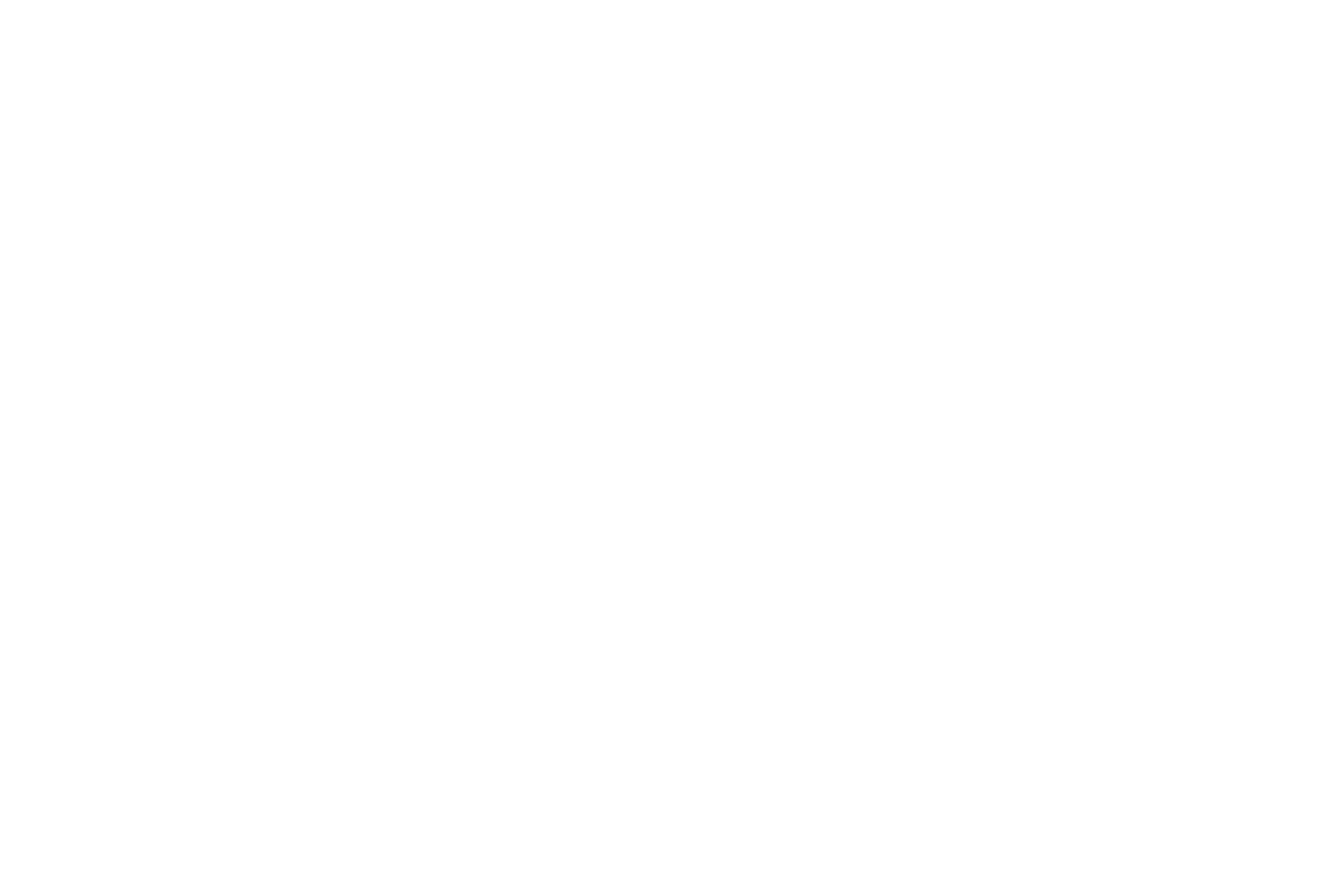
© Jan Windszus Photography
»Der derbste Ulk«: Richard Strauss’ Don Quixote
In den Jahren von 1896 bis 1898 arbeitete Richard Strauss parallel an zwei Werken, die er als Komplementärstücke konzipierte und die beide ohne Umschweife einen Helden in den erzählerischen Mittelpunkt stellten. Im einen der Werke, Ein Heldenleben op. 40, ist der Held nicht näher benannt, doch Strauss hat durch reichliche Eigenzitate im Satz »Des Heldens Friendenswerke« kaum einen Zweifel daran gelassen, dass er selbst der in der Sinfonischen Dichtung porträtierte Hauptcharakter ist. Das vom Komponisten selbst als komisches »Satyrspiel« bezeichnete Gegenstück zum Heldenleben bildet der bereits 1897 fertiggestellte Don Quixote. Fantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters op. 35. Natürlich steht hier jener »Ritter von der traurigen Gestalt« im Mittelpunkt, den der große spanische Dichter Miguel de Cervantes Anfang des 17. Jahrhunderts für immer in die höchsten Höhen der Weltliteratur entließ.
Im Heldenleben hatte sich Strauss für eine zyklische Anlage nach Art einer Sinfonie entschieden – wohl auch, um seinem Helden (also ihm selbst) eine entsprechende formalästhetische Fallhöhe zu verleihen. Für den Don Quixote hingegen wählte er – auf den ersten Blick durchaus überraschend – die Variationsform, die man vorderhand nicht gerade mit erzählerischen Elementen assoziiert. Doch Strauss ist hier auf mehreren Ebenen als Parodist und Komiker unterwegs: Zum einen hielt er die Variationsform für veraltet, eigentlich sei sie nur noch etwas für verrückte, unzeitgemäße Komponisten. Er benutzte sie trotzdem, um damit zugleich etwas über seinen in alten, ebenso unzeitgemäßen Ritterromanen schwelgenden Helden Don Quixote auszusagen. Zum anderen aber machte er sich über die Variationsform lustig, indem er sie – nach eigener Aussage – »ad absurdum« führte. Den konventionellen Weg, ein Thema aufzustellen und es fortschreitend zu entwickeln, beschritt er gerade nicht, vielmehr sind seine Variationen Episoden, in denen sein Held in unterschiedlichste Abenteuer und in die mit ihnen zusammenhängenden Klangwelten gestürzt wird. Dabei schreckte er auch vor ungemein plastischen Effekten nicht zurück – etwa vor der ziemlich naturgetreuen Nachahmung einer Hammelherde. Es sei »der derbste Ulk, den sich je ein Componist mit dem Orchester, und uns dünkt, auch mit seinen Zuhörern erlaubt hat«, urteilte ein zeitgenössischer Rezensent.
Im Heldenleben hatte sich Strauss für eine zyklische Anlage nach Art einer Sinfonie entschieden – wohl auch, um seinem Helden (also ihm selbst) eine entsprechende formalästhetische Fallhöhe zu verleihen. Für den Don Quixote hingegen wählte er – auf den ersten Blick durchaus überraschend – die Variationsform, die man vorderhand nicht gerade mit erzählerischen Elementen assoziiert. Doch Strauss ist hier auf mehreren Ebenen als Parodist und Komiker unterwegs: Zum einen hielt er die Variationsform für veraltet, eigentlich sei sie nur noch etwas für verrückte, unzeitgemäße Komponisten. Er benutzte sie trotzdem, um damit zugleich etwas über seinen in alten, ebenso unzeitgemäßen Ritterromanen schwelgenden Helden Don Quixote auszusagen. Zum anderen aber machte er sich über die Variationsform lustig, indem er sie – nach eigener Aussage – »ad absurdum« führte. Den konventionellen Weg, ein Thema aufzustellen und es fortschreitend zu entwickeln, beschritt er gerade nicht, vielmehr sind seine Variationen Episoden, in denen sein Held in unterschiedlichste Abenteuer und in die mit ihnen zusammenhängenden Klangwelten gestürzt wird. Dabei schreckte er auch vor ungemein plastischen Effekten nicht zurück – etwa vor der ziemlich naturgetreuen Nachahmung einer Hammelherde. Es sei »der derbste Ulk, den sich je ein Componist mit dem Orchester, und uns dünkt, auch mit seinen Zuhörern erlaubt hat«, urteilte ein zeitgenössischer Rezensent.
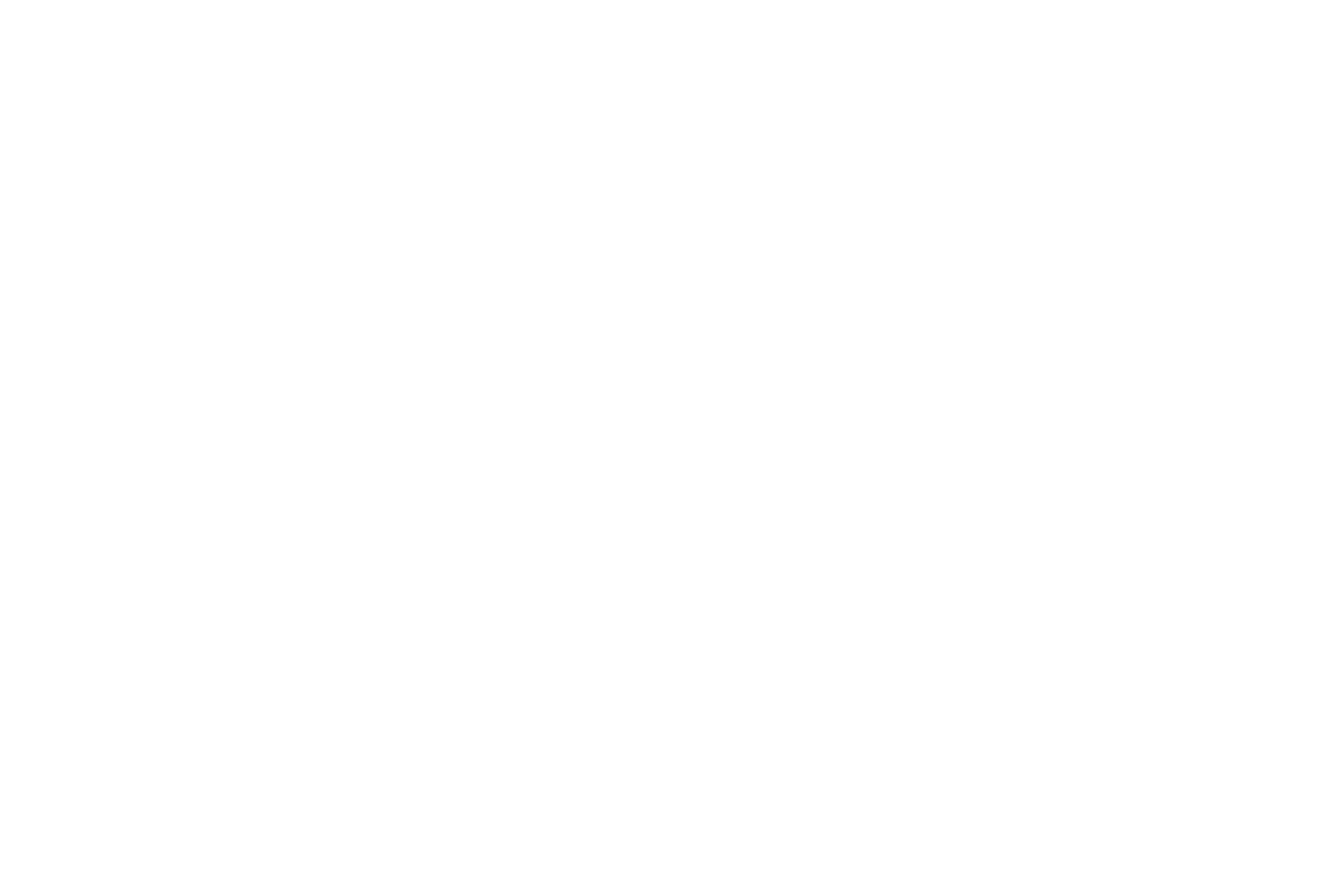
© Jan Windszus Photography
Die Orientierung im Don Quixote ist nicht immer leicht, auch weil die Variationen teils sehr unterschiedliche Längen aufweisen und somit eher einer Romanstruktur als einer innermusikalischen Logik folgen. Daher soll hier ein kurzer und höchst unvollständiger Hör-Leitfaden folgen.
Introduktion: Wenn man eigentlich auf das Thema wartet, kann einem die Introduktion gefühlt sehr lang erscheinen: Sie dauert bereits ungefähr sechs Minuten. Schlägt sie zu Beginn noch einen humoristischen »Es war einmal«-Tonfall an, wendet sie sich bald ihrem eigentlichen Inhalt zu und schildert das zunehmende Sich-Verlieren Don Quixotes in seiner Lektüre, den alten Ritterromanen, und seinen Entschluss, nun selbst ein Ritter zu werden.
Thema: Don Quixote wird, mit durchaus nobler und ausladender Geste, durch das ihn in der Folge darstellende Instrument eingeführt: das Solo-Violoncello. Ihm zur Seite tritt sein treuer Schildknappe Sancho Panza, der von der Solo-Viola repräsentiert wird.
Variation I: Das zugrundeliegende Abenteuer – Don Quixote glaubt in einigen Windmühlen Riesen zu erkennen und reitet gegen sie an – ist nicht wirklich plastisch gegriffen. Es herrscht eine elegisch-heroische Grundstimmung.
Variation II: Nun geht’s allerdings sehr konkret zur Sache: Don Quixote glaubt dem Heer des Königs Alifanfaron, Herrschers über die Insel Trapobano, zu begegnen. In Wirklichkeit ist es eine Hammelherde, die im Orchester äußerst suggestiv blöken darf.
Variation III: Diese mit über acht Minuten längste Variation beginnt als Gespräch zwischen dem zweifelnden Knappen und seinem Herrn, natürlich von den beiden Soloinstrumenten dargestellt. Don Quixote ist um Antwort nicht verlegen und verheißt seinem Knappen am Ende der Variation – mit unverkennbar schwärmerischem Duktus – ein Königreich.
Variation IV: Don Quixote hat neue Feinde ausgemacht, eine Gruppe von Pilgern, deren sakraler Gesang deutlich zu vernehmen ist. Er glaubt, sie hätten eine Jungfer entführt, in Wirklichkeit ist es das Bildnis der Jungfrau Maria.
Variation V: Der Held träumt von seiner Dame, der von ferne angebeteten Dulzinea von Toboso. Harfenglissandi unterstreichen seine Sehnsucht.
Introduktion: Wenn man eigentlich auf das Thema wartet, kann einem die Introduktion gefühlt sehr lang erscheinen: Sie dauert bereits ungefähr sechs Minuten. Schlägt sie zu Beginn noch einen humoristischen »Es war einmal«-Tonfall an, wendet sie sich bald ihrem eigentlichen Inhalt zu und schildert das zunehmende Sich-Verlieren Don Quixotes in seiner Lektüre, den alten Ritterromanen, und seinen Entschluss, nun selbst ein Ritter zu werden.
Thema: Don Quixote wird, mit durchaus nobler und ausladender Geste, durch das ihn in der Folge darstellende Instrument eingeführt: das Solo-Violoncello. Ihm zur Seite tritt sein treuer Schildknappe Sancho Panza, der von der Solo-Viola repräsentiert wird.
Variation I: Das zugrundeliegende Abenteuer – Don Quixote glaubt in einigen Windmühlen Riesen zu erkennen und reitet gegen sie an – ist nicht wirklich plastisch gegriffen. Es herrscht eine elegisch-heroische Grundstimmung.
Variation II: Nun geht’s allerdings sehr konkret zur Sache: Don Quixote glaubt dem Heer des Königs Alifanfaron, Herrschers über die Insel Trapobano, zu begegnen. In Wirklichkeit ist es eine Hammelherde, die im Orchester äußerst suggestiv blöken darf.
Variation III: Diese mit über acht Minuten längste Variation beginnt als Gespräch zwischen dem zweifelnden Knappen und seinem Herrn, natürlich von den beiden Soloinstrumenten dargestellt. Don Quixote ist um Antwort nicht verlegen und verheißt seinem Knappen am Ende der Variation – mit unverkennbar schwärmerischem Duktus – ein Königreich.
Variation IV: Don Quixote hat neue Feinde ausgemacht, eine Gruppe von Pilgern, deren sakraler Gesang deutlich zu vernehmen ist. Er glaubt, sie hätten eine Jungfer entführt, in Wirklichkeit ist es das Bildnis der Jungfrau Maria.
Variation V: Der Held träumt von seiner Dame, der von ferne angebeteten Dulzinea von Toboso. Harfenglissandi unterstreichen seine Sehnsucht.
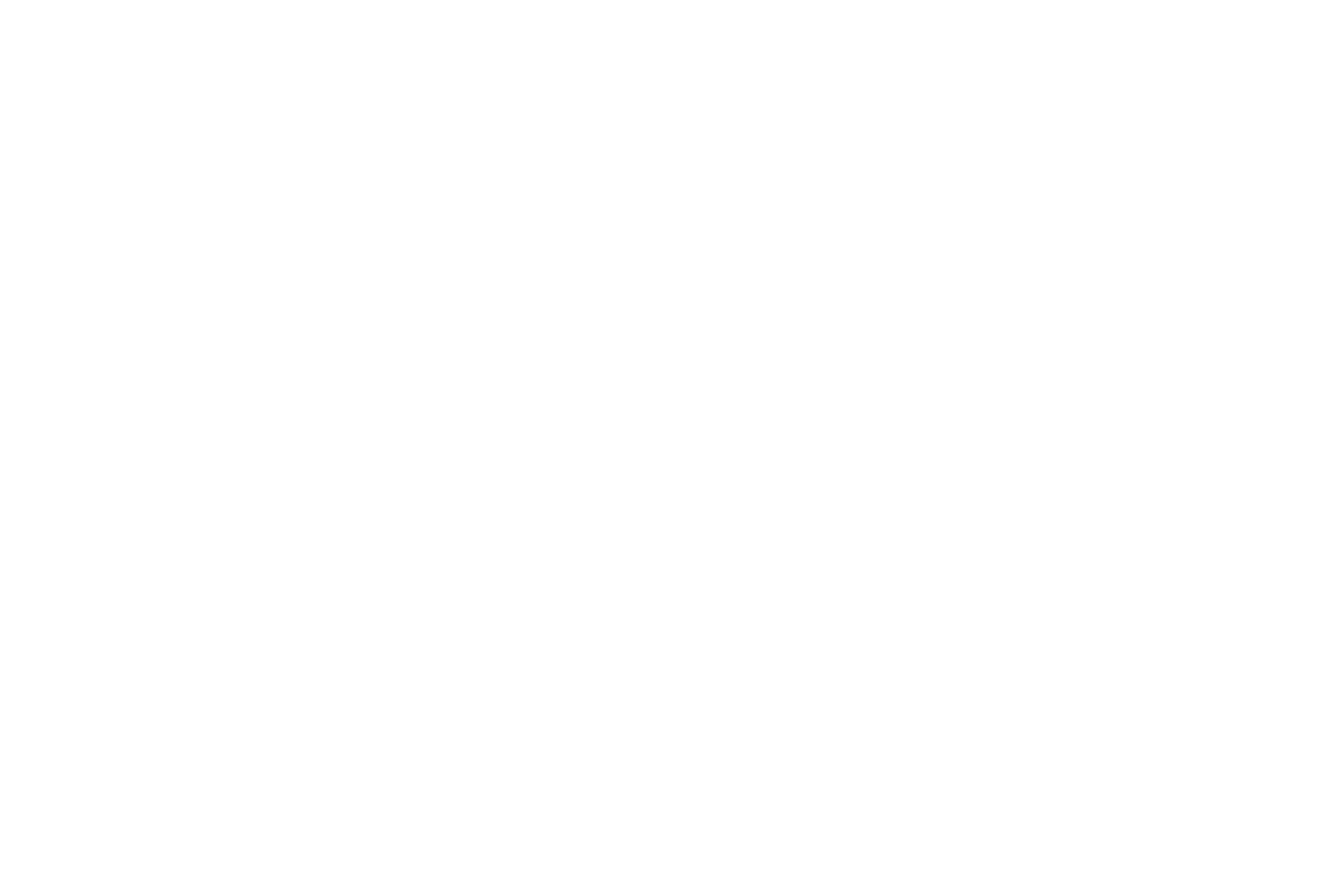
© Jan Windszus Photography
Variation VI: Eine bäurische Weise leitet diese nur gut einminütige Variation ein – sie steht für Don Quixotes Begegnung mit der »echten« Dulzinea, einem Bauernmädchen.
Variation VII: Die Windmaschine deutet es an: Don Quixote und Sancho Panza reiten durch die Luft.
Variation VIII: Don Quixote und Sancho begeben sich mit einem Boot, das sie vorgefunden haben, auf eine Flussfahrt. Sie kentern schließlich, und das Wasser tropft mit Streicher-Pizzicati an ihnen herunter. Es folgt ein kurzes Dankgebet für die Rettung.
Variation IX: Zwei harmlose Mönche, dargestellt von zwei Fagotten, reiten auf Maultieren daher. Don Quixote hält sie für Zauberer und schlägt sie in die Flucht.
Variation X: Ein wohlmeinender Nachbar Don Quixotes versucht, diesen zur Besinnung zu bringen. Als »Ritter vom blanken Monde« besiegt er ihn im Zweikampf. Don Quixote kehrt nach Hause zurück.
Finale: In friedlicher Stimmung und melodienseligem D-Dur blicken wir mit Don Quixote auf sein bewegtes Leben zurück und erleben sein sanftes Entschlafen.
Variation VII: Die Windmaschine deutet es an: Don Quixote und Sancho Panza reiten durch die Luft.
Variation VIII: Don Quixote und Sancho begeben sich mit einem Boot, das sie vorgefunden haben, auf eine Flussfahrt. Sie kentern schließlich, und das Wasser tropft mit Streicher-Pizzicati an ihnen herunter. Es folgt ein kurzes Dankgebet für die Rettung.
Variation IX: Zwei harmlose Mönche, dargestellt von zwei Fagotten, reiten auf Maultieren daher. Don Quixote hält sie für Zauberer und schlägt sie in die Flucht.
Variation X: Ein wohlmeinender Nachbar Don Quixotes versucht, diesen zur Besinnung zu bringen. Als »Ritter vom blanken Monde« besiegt er ihn im Zweikampf. Don Quixote kehrt nach Hause zurück.
Finale: In friedlicher Stimmung und melodienseligem D-Dur blicken wir mit Don Quixote auf sein bewegtes Leben zurück und erleben sein sanftes Entschlafen.
»Neuer Atem«: Claude Debussys »L’après-midi d’un faune«
Der Komponist Paul Dukas äußerte einmal die Vermutung, dass der größte Einfluss auf Claude Debussy nicht von anderen Komponisten ausgegangen sei, sondern von Schriftstellern und Dichtern. Das ist nicht von der Hand zu weisen: Wohl kaum ein anderer Komponist war so literarisch interessiert und gebildet wie Debussy. Nicht zuletzt gelang es ihm als einzigem Komponisten überhaupt, Zutritt zu einer besonders erlesenen Gruppe von Literaten zu erlangen, zum Dienstagskreis des großen symbolistischen Dichters Stephane Mallarmé. Ab etwa 1892 dürfte Debussy bei diesen sogenannten »Mardisten« zu Gast gewesen sein – man kam dort nur auf Einladung Mallarmés persönlich hin. Würde man die Listen dieser Zusammenkünfte veröffentlichen, würden sie sich wie ein »Who’s Who« des intellektuellen Paris lesen – und auch der deutsche Dichter Stefan George empfing hier die Anregung zum Aufbau seines eigenen, später so berühmt gewordenen Kreises.
Mallarmé sprach bei den dienstäglichen Treffen in der Regel frei assoziierend zu verschiedenen Themen – wobei ihm eine charismatische Redegabe zu Gebote stand. Hier wird er sicherlich auch die ästhetischen Grundlagen seiner Dichtkunst offengelegt haben, zu denen die zentrale Maxime gehörte: »Peindre non la chose, mais l’effet qu’elle produit.« (»Male nicht die Sache, sondern die Wirkung, die sie erzeugt.«) Schon vor seinen Besuchen bei den Mardisten war Debussy auf ein Gedicht Mallarmés gestoßen, welches diese Maxime offensichtlich beherzigte: L’après-midi d’un faune (»Der Nachmittag eines Fauns«), zwischen 1865 und 1867 geschrieben, 1876 veröffentlicht. Dem Gedicht liegt keine konkrete Handlung (keine »Sache«) zugrunde, der Monolog seines Helden, des Fauns, verharrt vielmehr in einem unklaren Status: Der Faun – ein antiker Wald- und Naturgott – ist gerade erwacht und erzählt nun – ja, was? Einen Traum? Eine tatsächliche Begebenheit? Nymphen spielen eine Rolle, denen er nachstellte, als er gerade eine Flöte schnitzte (die man sich als Panflöte vorstellen darf). Hat er sich an den Nymphen vergangen? Ist er durch sein unleugbar erwachtes erotisches Verlangen schuldig geworden? Über diesen Gedanken schläft der Faun, von reichem Weingenuss schwer geworden, wieder ein. Leser:innen des Gedichts werden eher seine artifiziell sinnliche und rauschhafte Wirkung wahrnehmen als eine klar umrissene Kontur.
Mallarmé sprach bei den dienstäglichen Treffen in der Regel frei assoziierend zu verschiedenen Themen – wobei ihm eine charismatische Redegabe zu Gebote stand. Hier wird er sicherlich auch die ästhetischen Grundlagen seiner Dichtkunst offengelegt haben, zu denen die zentrale Maxime gehörte: »Peindre non la chose, mais l’effet qu’elle produit.« (»Male nicht die Sache, sondern die Wirkung, die sie erzeugt.«) Schon vor seinen Besuchen bei den Mardisten war Debussy auf ein Gedicht Mallarmés gestoßen, welches diese Maxime offensichtlich beherzigte: L’après-midi d’un faune (»Der Nachmittag eines Fauns«), zwischen 1865 und 1867 geschrieben, 1876 veröffentlicht. Dem Gedicht liegt keine konkrete Handlung (keine »Sache«) zugrunde, der Monolog seines Helden, des Fauns, verharrt vielmehr in einem unklaren Status: Der Faun – ein antiker Wald- und Naturgott – ist gerade erwacht und erzählt nun – ja, was? Einen Traum? Eine tatsächliche Begebenheit? Nymphen spielen eine Rolle, denen er nachstellte, als er gerade eine Flöte schnitzte (die man sich als Panflöte vorstellen darf). Hat er sich an den Nymphen vergangen? Ist er durch sein unleugbar erwachtes erotisches Verlangen schuldig geworden? Über diesen Gedanken schläft der Faun, von reichem Weingenuss schwer geworden, wieder ein. Leser:innen des Gedichts werden eher seine artifiziell sinnliche und rauschhafte Wirkung wahrnehmen als eine klar umrissene Kontur.
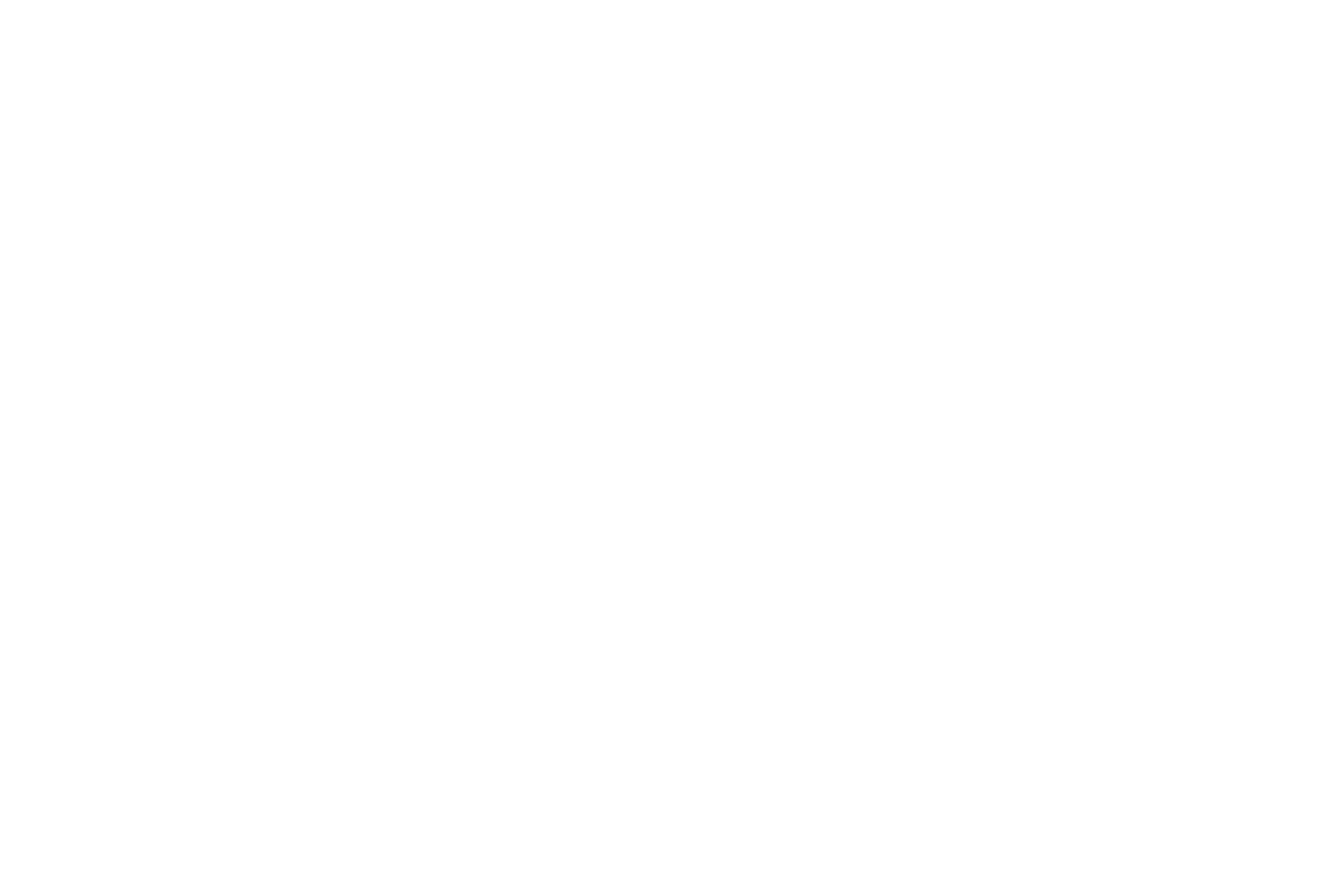
© Jan Windszus Photography
Claude Debussy begann um 1890 damit, diesen seltsamen Helden Mallarmés in ein Tongedicht zu kleiden. Erst 1894 nahm dieses Prélude à l’après-midi d’un faune seine endgültige Gestalt an. Und natürlich beherzigte auch der Komponist die Maxime Mallarmés und strebte keine Eins-zu-eins-Nachahmung des Faun-Gedichts an. Nach eigenem Bekunden will er »es eigentlich gar nicht nacherzählen, sondern die verschiedenen Stimmungen erwecken, in deren Mitte die Begierden und Träume des Fauns sich entwickeln. Ermüdet davon, die furchtsamen Nymphen und scheuen Najaden zu verfolgen, gibt er sich einem Höhepunkt der Lust hin, zu dem der Traum eines endlich erfüllten Wunsches führt: des vollkommenen Besitzes der ganzen Natur.« Ganz nebenbei setzte Debussy damit einen Meilenstein der später als impressionistisch apostrophierten Musik. Oder gar der modernen Musik insgesamt, wie der Dirigent und Komponist Pierre Boulez im Hinblick auf die berühmte Flötenmelodie des Stückanfangs meinte: »Mit der Flöte des Fauns hat die Musik begonnen, neuen Atem zu schöpfen. Man kann sagen, dass die moderne Musik mit L’après-midi d’un faune beginnt.«
»Uralter Ruhm«: Ottorino Respighis »Pini di Roma«
Waren bei Richard Strauss die beiden (Anti-)Helden Don Quixote und Sancho noch sehr figürlich anwesend und der Faun bei Debussy immerhin als berauscht träumende Sprecherinstanz noch wirksam, so sind die Helden in Ottorino Respighis Pini di Roma schon gar nicht mehr da. Respighi entwickelte vor allem in seinem späteren Schaffen ein Faible für alles Alte und Vergangene: So beschäftigte er sich etwa mit Tänzen und Arien aus der Vergangenheit und arrangierte diese für ein modernes Instrumentarium, zudem bewunderte er die Antike in allen ihren Facetten und versuchte, sie mit seinen Mitteln wieder heraufzubeschwören. Und seine Mittel waren die einer extrem farbigen Orchesterpalette, die nicht zuletzt auch den Kompositionen Debussys einiges zu verdanken hat. Es wäre sicherlich zu viel gesagt, Respighi als bedeutendsten italienischen Komponisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu bezeichnen (da sei Puccini vor!), doch im Bereich des reinen Instrumentalschaffens darf man das wohl doch behaupten.
Vor allem seine drei Sinfonischen Dichtungen auf römische Sujets sollten ihm Weltruhm verschaffen: Fontane di Roma (»Die Brunnen von Rom«, 1916), Pini di Roma (»Die Pinien von Rom«, 1924) und Feste Romane (»Römische Feste«, 1928). In den Pini di Roma malte er dabei eine Landschaft, in der die Größe einer heroischen Vergangenheit zwar noch nachhallt, im Grunde aber längst versunken ist. Wobei sie auch noch höchst gegenwärtige Folgen haben kann, wenn etwa im ersten Satz übermütige Kinder die einstigen Schlachten nachspielen. In Respighis Worten: »Zwischen den Pinien der Villa Borghese spielen die Kinder. Sie tanzen Ringelreih’n, führen Militärmärsche und Schlachten auf und berauschen sich an ihrem eigenen Geschrei wie Schwalben am Abend; dann laufen sie davon …« Respighi verwendet reale Kinderlied-Partikel und harte Schnitte, um einen regelrecht tumultuösen Effekt zu erzielen.
Zum zweiten Satz schrieb Respighi: »Unvermutet wechselt die Szene. Zum Schatten der Pinien rings um den Eingang einer Katakombe, aus deren Tiefe ein wehmütiger Gesang zu uns dringt. Er erhebt sich zu feierlicher Hymne und verklingt dann wieder.« Die traurige Melodie einer Trompete, ein sich langsam aufbauendes ostinates Motiv und archaisierende Harmonik verhelfen diesem Satz zu seiner sehr eigenen Atmosphäre.
Vor allem seine drei Sinfonischen Dichtungen auf römische Sujets sollten ihm Weltruhm verschaffen: Fontane di Roma (»Die Brunnen von Rom«, 1916), Pini di Roma (»Die Pinien von Rom«, 1924) und Feste Romane (»Römische Feste«, 1928). In den Pini di Roma malte er dabei eine Landschaft, in der die Größe einer heroischen Vergangenheit zwar noch nachhallt, im Grunde aber längst versunken ist. Wobei sie auch noch höchst gegenwärtige Folgen haben kann, wenn etwa im ersten Satz übermütige Kinder die einstigen Schlachten nachspielen. In Respighis Worten: »Zwischen den Pinien der Villa Borghese spielen die Kinder. Sie tanzen Ringelreih’n, führen Militärmärsche und Schlachten auf und berauschen sich an ihrem eigenen Geschrei wie Schwalben am Abend; dann laufen sie davon …« Respighi verwendet reale Kinderlied-Partikel und harte Schnitte, um einen regelrecht tumultuösen Effekt zu erzielen.
Zum zweiten Satz schrieb Respighi: »Unvermutet wechselt die Szene. Zum Schatten der Pinien rings um den Eingang einer Katakombe, aus deren Tiefe ein wehmütiger Gesang zu uns dringt. Er erhebt sich zu feierlicher Hymne und verklingt dann wieder.« Die traurige Melodie einer Trompete, ein sich langsam aufbauendes ostinates Motiv und archaisierende Harmonik verhelfen diesem Satz zu seiner sehr eigenen Atmosphäre.
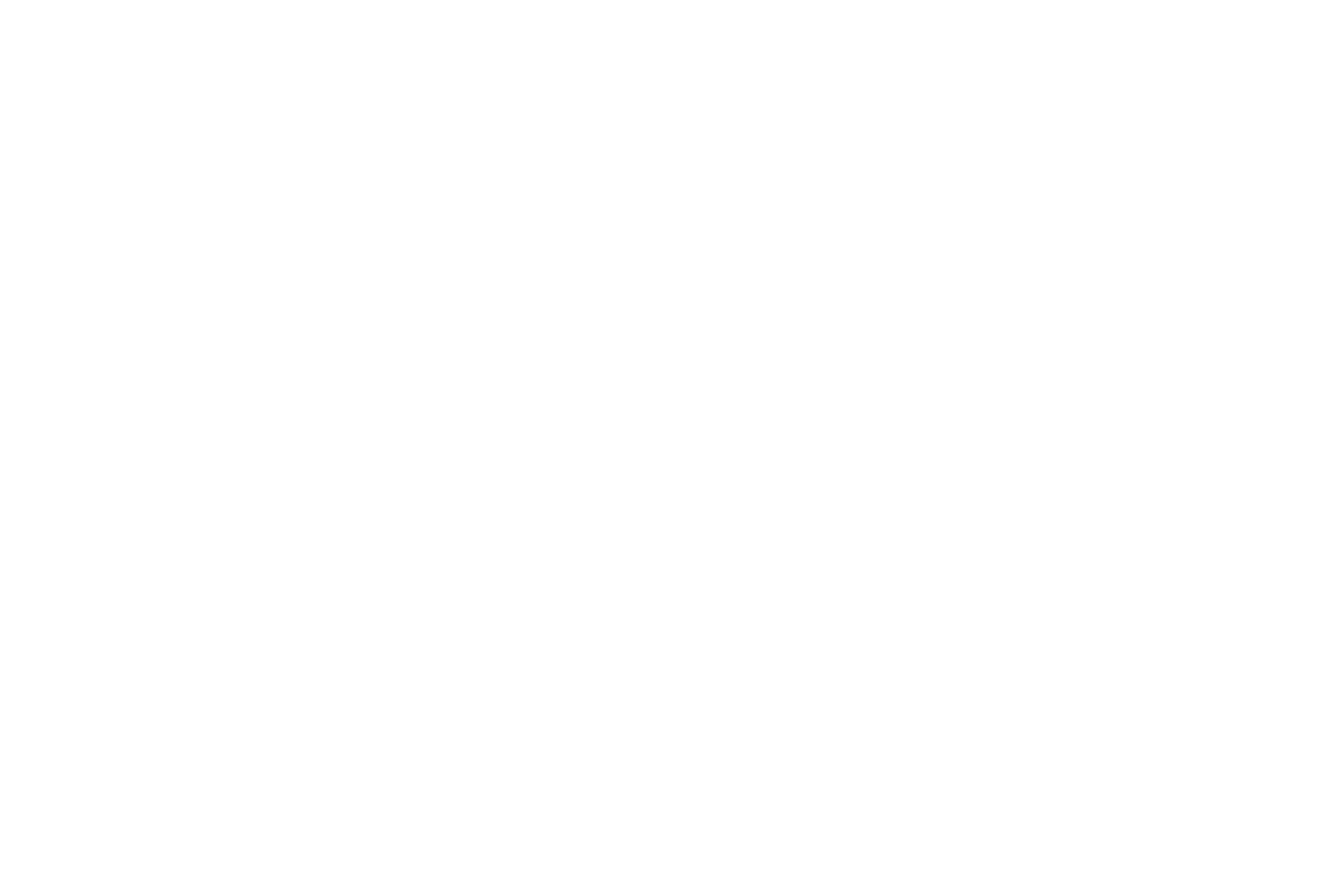
© Jan Windszus Photography
Im dritten Satz geht »ein Zittern durch die Luft: in klarer Vollmondnacht wiegen die Pinien des Janiculum sanft ihre Wipfel. In den Zweigen singt eine Nachtigall.« Diese Nachtigall hat am Ende des Satzes einen spektakulären Auftritt: Respighi schrieb in der Partitur vor, dass die Originalaufnahme einer Nachtigall von einer ganz bestimmten Schallplatte eingespielt werden müsse (und nahm damit Techniken der sogenannten Musique concrète vorweg, die sich erst zwei Jahrzehnte später formieren sollte). Und so lauschen wir bis heute an dieser Stelle einer Nachtigall, die ihr Lied wohl um 1920 gesungen haben dürfte.
Der letzte Satz in den Worten Respighis: »Morgennebel über der Via Appia. Einsame Pinien stehen Wacht in der tragischen Landschaft der römischen Campagna. Undeutlich, aber immer wieder glaubt man den Rhythmus zahlloser Schritte zu hören. Der Dichter sieht im Geiste uralten Ruhm wieder aufleben: Unter dem Geschmetter der Buccinen [römische Naturtrompeten] naht ein Konsul mit seinen Legionen, um im Glanz der aufgehenden Sonne zur Via sacra und zum Tempel auf das Kapitol zu ziehen.« Es sind diese römischen Helden, von denen Respighi träumte – Helden, die längst abwesend waren. Dass mit den Faschisten neue, sehr zweifelhafte Helden in Italien an die Macht gekommen waren, hat Respighi weder begrüßt noch kritisiert. Was aber die neuen römischen Helden alles anrichteten, hat er nicht mehr bis zum bitteren Ende verfolgen müssen – er starb 1936.
Der letzte Satz in den Worten Respighis: »Morgennebel über der Via Appia. Einsame Pinien stehen Wacht in der tragischen Landschaft der römischen Campagna. Undeutlich, aber immer wieder glaubt man den Rhythmus zahlloser Schritte zu hören. Der Dichter sieht im Geiste uralten Ruhm wieder aufleben: Unter dem Geschmetter der Buccinen [römische Naturtrompeten] naht ein Konsul mit seinen Legionen, um im Glanz der aufgehenden Sonne zur Via sacra und zum Tempel auf das Kapitol zu ziehen.« Es sind diese römischen Helden, von denen Respighi träumte – Helden, die längst abwesend waren. Dass mit den Faschisten neue, sehr zweifelhafte Helden in Italien an die Macht gekommen waren, hat Respighi weder begrüßt noch kritisiert. Was aber die neuen römischen Helden alles anrichteten, hat er nicht mehr bis zum bitteren Ende verfolgen müssen – er starb 1936.
#KOBSiKo
27. Januar 2026
Ein Schlag ins Gesicht
Ein Gespräch mit Dirigent James Gaffigan über die russische Sprache, extremes Musiktheater und die Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit
#KOBLadyMacbeth
Interview
15. Dezember 2025
Neue Chancen, neues Glück
Matthes macht's – so heißt das Neujahrskonzert, das der Schauspieler Ulrich Matthes für die Komische Oper Berlin kuratiert. Von Gershwins pulsierendem Klavierkonzert bis hin zu Arvo Pärts herausfordernder Stille: Matthes Konzertprogramm eröffnet das Neue Jahr mit großer Zuversicht, die Freude und Glück verspricht, Trost spendet und zu einem offenen Blick herausfordert. Ganz so, als würde der seriös-tragische Ernst Heinrich von Kleists auf den Hopsasa-Humor von Louis de Funès treffen. Ein Gespräch über Frühstücksrituale, Großstadtklänge und den Musikgeschmack von Herbert und Monika.
#KOBSiKo
23. November 2025
Generalmusikdirektor James Gaffigan spitzt den Klang mit dem Orchester der Komischen Oper... zu. Von den aufsteigenden Klarinetten des ersten Takts an flirrt und gleißt es – mit einem klaren Akzent auf Blech und Schlagwerk. Hörner, Trompeten, Posaunen und Tuben klingen hier schmeichelnd sämig, dann wieder schneidend brutal… Aber die zentralen Momente erblühen plastisch und klar oder knallen einem beeindruckend um die Ohren – und erzählen so von einer Gewalt, die auf der Bühne mit teils drastischen Bildern Wirklichkeit wird.
Georg Kasch, Berliner Morgenpost, 23.11.2025
Salome-Premiere: Ein blutiger Traum zwischen Liebe und Wahnsinn
Salome-Premiere: Ein blutiger Traum zwischen Liebe und Wahnsinn
#KOBSalome
23. November 2025
Ein bestürzender und hochspannender »Salome«-Abend: Regisseur Evgeny Titov lässt die grandiose Nicole Chevalier ohne Kopf auftreten. Generalmusikdirektor James Gaffigan setzt auf eine glanzvoll rauschende und raunende Klangtextur der revolutionären Partitur.
Roland Dippel, concerti, 23.11.2025
Kahlschlag aus Liebe
Kahlschlag aus Liebe
#KOBSalome
23. November 2025
Titovs Personenführung ist brillant: Weil sie sich im Klangfluss der Partitur bewegen dürfen, weil jede Geste aus dem musikalischen Impuls entwickelt wird, können die Sänger zu Schauspielern werden, auf eine Art, wie man es selten sieht...
Was für eine exzellente Künstlergemeinschaft hier zusammenkommt. Günter Papendell untermauert erneut seine Stellung als Star des Ensembles... Angemessen geifernd und grellstimmig gerät Matthias Wohlbrecht der Herodes, zur auratischen Erscheinung macht Karolina Gumos Herodias... Agustín Gómez’ Narraboth verschmachtet sich berührend nach Salome, eindringlich warnt Susan Zarrabis Page vor dem drohenden Unheil. Wie Nicole Chevalier die mörderische Titelpartie unter ihrer weißen Schutzhaube bewältigt, nötigt Respekt ab, wie sie es schafft, der Gesichtslosen dennoch ein Profil zu verleihen, brillant in der Bewegungs-Choreografie, mit enormem musikalischem Ausdrucksspektrum.
Was für eine exzellente Künstlergemeinschaft hier zusammenkommt. Günter Papendell untermauert erneut seine Stellung als Star des Ensembles... Angemessen geifernd und grellstimmig gerät Matthias Wohlbrecht der Herodes, zur auratischen Erscheinung macht Karolina Gumos Herodias... Agustín Gómez’ Narraboth verschmachtet sich berührend nach Salome, eindringlich warnt Susan Zarrabis Page vor dem drohenden Unheil. Wie Nicole Chevalier die mörderische Titelpartie unter ihrer weißen Schutzhaube bewältigt, nötigt Respekt ab, wie sie es schafft, der Gesichtslosen dennoch ein Profil zu verleihen, brillant in der Bewegungs-Choreografie, mit enormem musikalischem Ausdrucksspektrum.
Frederik Hanssen, Der Tagesspiegel, 23.11.2025
»Salome« feiert Premiere: Brillante Personenregie und Orchesterwucht an der Komischen Oper Berlin
»Salome« feiert Premiere: Brillante Personenregie und Orchesterwucht an der Komischen Oper Berlin
#KOBSalome
18. November 2025
Dichter ohne Worte
Von Claude Debussy hat er viel über das Wesen französischer Musik gelernt, von Richard Strauss, wie komplex die Schönheit des Einfachen ist und von Ottorino Respighi, wie Filme ohne Leinwand entstehen – ein Gespräch mit Generalmusikdirektor James Gaffigan über das Sinfoniekonzert Heldenträume und die Kunst sinfonischer Dichtung.
#KOBSiKo
Interview
16. November 2025
Glücksrausch mit Dissonanzen
Ein Gespräch mit Generalmusikdirektor James Gaffigan über Richard Strauss’ Brillanz und Salomes Ekstasen
#KOBSalome
Interview
25. September 2025
Ich glaube, die 8. Sinfonie war Mahlers Liebesbrief, nicht nur an seine Frau Alma, sondern an die ganze Welt. Und in seinen Augen war dies sein wichtigstes Werk. Diese Sinfonie ist wie kosmische Liebe. Das klingt sehr hippiemäßig, als würde ich über Jesus Christ Superstar sprechen. Aber letztendlich geht es in Mahlers Achter darum, das Leben durch Liebe anzunehmen.
James Gaffigan im Gespräch mit Carolin Pirich auf radio3 über monumentale Musik an einem monumentalen Ort und absoluter Hingabe an Gustav Mahlers 'Sinfonie der Tausend'.
#KOBSiKo
18. September 2025
Klang des Unbeschreiblichen
1.030 Mitwirkende. Zwei gigantische Aufführungen. Ein Mega-Event der Musikgeschichte. Die Uraufführung von Gustav Mahlers 8. Sinfonie 1910 in München war pure Spektakel-Inszenierung. Doch hinter dem Marketing-Rummel steckt mehr als Größenwahn. Mahler schuf ein tiefes Glaubensbekenntnis. Seine "Sinfonie der Tausend" verbindet den mittelalterlichen Pfingsthymnus "Veni, creator spiritus" mit Goethes Faust-Finale. Bei genauerer Betrachtung offenbart Gustav Mahlers 8. Sinfonie eine existenzielle Botschaft über Erlösung durch göttliche Liebe. Ein Blick hinter die Kulissen eines umstrittenen Meisterwerks.
#KOBSiKo
Einführung
28. April 2025
So farbenfroh wie düster, sphärisch wie turbulent inszeniert… intensiv… kurzweilig, voll Humor aber auch Tiefgang.
Barbara Wiegand, rbb24 inforadio
Kurzweilig und mit Tiefgang: Don Giovanni an der Komischen Oper
Kurzweilig und mit Tiefgang: Don Giovanni an der Komischen Oper
#KOBGiovanni
28. April 2025
Hochambitioniert und höchst unterhaltsam
Joachim Lange, concerti
Leben oder Tod – was tut's
Leben oder Tod – was tut's
#KOBGiovanni
22. April 2025
Wenn jemand über den Tod lachen könnte, dann Mozart
Mozarts Requiem und Don Giovanni zeigen die extreme Bandbreite seines Schaffens. Dunkle Schwere trifft auf schwarzen Humor, musikalische Schönheit auf existenzielle Abgründe. Mit wenigen Moll-Tonarten entfaltet Mozart eine emotionale Kraft, die bis heute unvergleichlich bleibt. Don Giovanni vereint in sich erschreckende und komische Momente, während das Requiem Lichtblicke und tiefe Dunkelheit verbindet. Verborgene Zitate und spontane Eingriffe zeugen von Mozarts Freiheitsdrang und Theaterleidenschaft. In einer besonderen Inszenierung werden Don Giovannis Höllenfahrt und das Requiem direkt verbunden – ein radikaler Schnitt, der Tod und Erlösung musikalisch verschmelzen lässt. Entsteht so ein letztes großes „Hurra“? Ein Gespräch mit Generalmusikdirektor James Gaffigan über den Pionier des schwarzen Humors, ein Mordsspektakel und das Beste zum Schluss.
#KOBGiovanni
Interview
11. Februar 2025
Diese Verbindung von stehendem und bewegtem Bild, beide unlöslich mit der akustischen Spur im Raum verbunden... ein berührender Dreiklang voller Poesie.
Katja Kollmann, taz
Berührende Kombinationen
Berührende Kombinationen
#KOBFestival
10. Februar 2025
Auf der Suche nach einer neuen Klangsprache
Von Feuertänzen, Stürzen und Bizarrerien – eine Einführung zum Sinfoniekonzert Date
#KOBSiKo
#KOBFestival
10. Februar 2025
»Everybody Now!« ist ein innovatives Format für das Berliner Kulturpublikum. Wer die Komfortzone verlässt wie die Komische Oper als Institution, kann Erfolg haben.
Matthias Nöther, Berliner Morgenpost
Festival: Auseinandersetzung mit weiblichen Genitalien
Festival: Auseinandersetzung mit weiblichen Genitalien
#KOBFestival
25. November 2024
Einfach schöne Musik
Ein Gespräch mit Herbert Fritsch über die Leichtigkeit Neuer Musik, die Schönheit chaotischer Rhythmen und mitreißende Spielfreude
#KOBSiKo
21. November 2024
Ekelhaft, Gruselig, Lustig!
Stephen Sondheims Musical Sweeney Todd ist das »perfekte Ineinandergreifen von Text und Musik, … in seiner orchestralen Pracht eindeutig das wirkungsvollste«, sagt James Gaffigan. Im Interview spricht Generalmusikdirektor der Komischen Oper Berlin über die musikalischen Einflüsse von Jazz, Bossa Nova bis Mozart und Mahler, Wagnerische Leitmotive und das Ertragen einer in der Tat ekelhaften Geschichte.
#KOBSweeneyTodd
Interview
18. November 2024
Musikalisch eine reine Freude. Der von David Cavelius einstudierte Chor ist in dieser Stadt als Opernchor zurzeit ohne Konkurrenz, gesanglich erweist er sich als ebenso überlegen wie in gestalterischer Schärfe und Spielfreude. Und James Gaffigan am Pult des Orchesters der Komischen Oper gelingt eine pointierte und farblich enorm reiche Interpretation, die in keinem Moment den Faden verliert. Man spürt den Spaß, den die Arbeit an einer so reizvoll zwischen kompositorischem Anspruch und Popularität oszillierenden Partitur machen muss. Die melodischen Reize ... gelingen so präsent, wie die hintergründige leitmotivische Struktur stets spürbar bleibt.
Peter Uehling, Berliner Zeitung
Die Komische Oper bringt »Sweeney Todd« und die beste Pastete von London auf die Bühne
Die Komische Oper bringt »Sweeney Todd« und die beste Pastete von London auf die Bühne
#KOBSweeneyTodd
10. Juni 2024
Flotte Sohle: Die »Roaring Twenties« und die Melancholie der Welt
Schmissige Rhythmen, nostalgische Melodien und visionäre Techniken: Die Komponisten des Sinfoniekonzerts Flotte Sohle sind durchaus keine Mauerblümchen, nein, sie wagten den Schritt ins kreative Niemandsland und wurden von Zeitgenoss:innen, Parteien, Landsmännern und -frauen sowie Fremden dafür verlacht und verboten. Mutig und entfesselt wagten sie sich aber dennoch aufs Parkett, inspiriert vom Jazz und voller innovativer Ideen, um die Musikwelt zum Tanzen zu bringen! Eine Einführung über visionäre Skandale, surrealistische Filmmusik und einen Totengräber des Tango...
#KOBSiKo
1. Mai 2024
Große Literatur, große Chöre, große Gefühle!
Schauspielerin Laura Balzer erweckt die furchtlose Frauenfigur Antigone in Mendelssohn Bartholdys Schauspielmusik zum Leben.
Unsere Chorsolisten kennen Sie natürlich als unübertroffen wandelbaren und wichtigen Teil unserer Inszenierungen. Im Sinfoniekonzert Antigone erleben Sie sie an diesem Freitag (3. Mai) gemeinsam mit dem Vocalconsort Berlin und dem Orchester der Komischen Oper Berlin unter der Leitung von David Cavelius erstmals konzertant auf der Bühne des Schillertheaters.
Neben Mendelssohn Bartholdys Theatermusik zu Antigone steht auch Schumanns Spanisches Liederspiel auf dem Programm – ein Ohrenschmaus für alle Chorbegeisterten!
Foto Laura Balzer © Stefan Klüter
Unsere Chorsolisten kennen Sie natürlich als unübertroffen wandelbaren und wichtigen Teil unserer Inszenierungen. Im Sinfoniekonzert Antigone erleben Sie sie an diesem Freitag (3. Mai) gemeinsam mit dem Vocalconsort Berlin und dem Orchester der Komischen Oper Berlin unter der Leitung von David Cavelius erstmals konzertant auf der Bühne des Schillertheaters.
Neben Mendelssohn Bartholdys Theatermusik zu Antigone steht auch Schumanns Spanisches Liederspiel auf dem Programm – ein Ohrenschmaus für alle Chorbegeisterten!
Foto Laura Balzer © Stefan Klüter
#KOBSiKo
Chorsolisten
28. April 2024
»Beeindruckend, wie nachhaltig Kirill Serebrennikow die Tiefendimension und die politische Stoßkraft der Macht- und Besitzverhältnisse in Mozarts »Le nozze di Figaro«, die Winkelzüge der Gefühle und des Gelächters, reflektiert und darstellen lässt ... Und wie enthusiastisch ihm das Ensemble der Komischen Oper durch das Comedia-Abenteuer all der Krümmungen und Windungen in Mozarts »Tollem Tag« folgt. Ungeteilt die Zustimmung im Berliner Schillertheater.«
»Le nozze di Figaro« von Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Schreiber, Süddeutsche Zeitung
»Le nozze di Figaro« von Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Schreiber, Süddeutsche Zeitung
#KOBFigaro
28. April 2024
»Dieses entfesselte Theater funktioniert als Ganzes vor allem, weil Tommaso Barea ein in jeder Hinsicht dunkel attraktiver Figaro ist und Hubert Zapiór sein smart arroganter Gegenspieler als Graf Almaviva. Dass Susanna die Frau ist, die hier eigentlich den größten Durchblick hat, wird von der beherzt frischen Penny Sofroniadou durchweg und darstellerisch beglaubigt. Nadja Mchantaf ist als Contessa längst desillusioniert, was die Dauerhaftigkeit von Liebesglück betrifft. Sie klingt auch melancholisch sanft. ... Am Pult des Orchesters der Komischen Oper sorgt James Gaffigan durchweg für die zupackende Dramatik, die diese szenische Deutung herausfordert, setzt ihr aber auch musikalisches Innehalten entgegen und sichert den Sängern Raum zur Entfaltung.«
»Le nozze di Figaro« von Wolfgang Amadeus Mozart
Joachim Lange, NMZ
»Le nozze di Figaro« von Wolfgang Amadeus Mozart
Joachim Lange, NMZ
#KOBFigaro
26. April 2024
Realität und Realitätsflucht
Ein Gespräch mit dem musikalischen Leiter James Gaffigan über gebrochene Herzen, das Genie Mozarts und Oper als Reflexionsort in Le nozze di Figaro
#KOBFigaro
25. April 2024
Geballte Chorpower
Händel, Mozart, Henze, Reimann, Tschaikowski und auch Straus. Ihre Bandbreite ist unglaublich! Nicht umsonst wurden unsere großartigen Chorsolisten mehrmals vom Magazin Opernwelt zum »Opernchor des Jahres« gewählt. Normalerweise erleben Sie sie ebenso munter tanzend wie hochprofessionell spielend. Doch am 3. Mai dreht sich alles um ihre Kernkompetenz: das Singen.
Beim Sinfoniekonzert Antigone steht Sophokles’ 2500 Jahre alter Widerstandstragödie Robert Schumanns Spanisches Liederspiel in einer eigens von Chordirektor David Cavelius arrangierten Fassung gegenüber. Es erwartet Sie ein literarisch-sinfonischer Abend, der die Frage nach der Vereinbarkeit von Eigensinn und Allgemeinwohl stellt.
Foto © Freese/drama-berlin.de
Beim Sinfoniekonzert Antigone steht Sophokles’ 2500 Jahre alter Widerstandstragödie Robert Schumanns Spanisches Liederspiel in einer eigens von Chordirektor David Cavelius arrangierten Fassung gegenüber. Es erwartet Sie ein literarisch-sinfonischer Abend, der die Frage nach der Vereinbarkeit von Eigensinn und Allgemeinwohl stellt.
Foto © Freese/drama-berlin.de
Chorsolisten
Sinfoniekonzert
#KOBSiKo
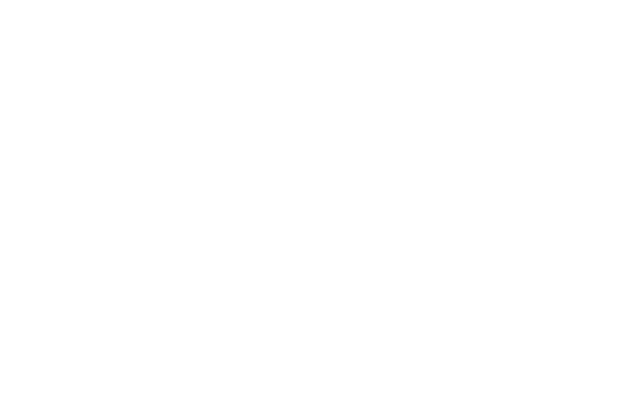
15. April 2024
»James Gaffigan hat Großes vor an der Komischen Oper Berlin, deren Generalmusikdirektor er seit dieser Saison ist: Der 44-jährige Amerikaner möchte die Musik ins Rampenlicht rücken, wo stets die Regie im Mittelpunkt stand: »Das Orchester ist ein Diamant«, schwärmt er, »den will ich zum Funkeln bringen.« Das Publikum soll spüren, was für großartige Instrumentalistinnen und Instrumentalisten hier spielen. Ein allzu ehrgeiziges Ziel? Als Amerikaner kennt Gaffigan keine Probleme. Nur Herausforderungen.«
Der Tagesspiegel hat James Gaffigan nicht nur mit dieser Begründung zu einem der 100 wichtigsten Köpfe der Berliner Kultur ausgezeichnet – wir gratulieren!
Foto © Jan Windszus Photography
Der Tagesspiegel hat James Gaffigan nicht nur mit dieser Begründung zu einem der 100 wichtigsten Köpfe der Berliner Kultur ausgezeichnet – wir gratulieren!
Foto © Jan Windszus Photography
Generalmusikdirektor
2. April 2024
Denk ich an Ostdeutschland …
Richard Wagner und Johann Sebastian Bach, Ruth Zechlin und Siegfried Matthus – mit zwei Leipziger Söhnen und zwei DDR-Ikonen begibt sich das Orchester der KOB unter der Leitung von James Gaffigan auf die Spuren ostdeutscher Musikgeschichte!
#KOBSiKo
30. Januar 2024
Stimmlich und darstellerisch grandios verkörpert Dmitry Ulyanov den König und verdeutlicht, warum es bei Kosky nicht leicht ist, ein Despot zu sein. ...
Sopranistin Kseniia Proshina wird gewissermaßen der rote Teppich ausgerollt. Was sie gar nicht nötig hat. Die Sängerin kann mit einer Eleganz verführen, ihr lyrischer Sopran bewegt sich voller Leichtigkeit durch die Partie, auch wenn sie die geforderten Spitzentöne nur anreißt.
Sopranistin Kseniia Proshina wird gewissermaßen der rote Teppich ausgerollt. Was sie gar nicht nötig hat. Die Sängerin kann mit einer Eleganz verführen, ihr lyrischer Sopran bewegt sich voller Leichtigkeit durch die Partie, auch wenn sie die geforderten Spitzentöne nur anreißt.
Fantasien eines einsamen Königs, Volker Blech, Berliner Morgenpost
#KOBGoldenerHahn
30. Januar 2024
Barry Koskys stupend präzise Inszenierung des „Goldenen Hahns“ hat schon eine kleine Reise hinter sich von Aix-en Provence über Lyon und Adelaide nach Berlin , an die Komische Oper, also ans Schillertheater, das derzeitige Quartier der Truppe. ... Der Dirigent James Gaffigan wirkt, als habe er sich vollkommen in diese Musik verknallt, er umsorgt jedes kleinste Detail, er schildert plastisch, aufregend, elegant. Proshina und Ulyanov müssten gar nichts singen, die Musik erzählte alles, bohrende Neugierde am anderen, von ihr ironisch, spielerisch, verführerisch dargeboten.
Irre werden an der Schönheit, Egbert Tholl, Süddeutsche Zeitung
#KOBGoldenerHahn
29. Januar 2024
Das war ein runder, voller Erfolg! Die Komische Oper hat gepunktet. Und zwar mit einem Werk, das ja wirklich ans Haus passt. ... Es ist keine platte Aktualisierung, es ist für Kosky ein Märchen und es geht um die Magie der Bilder. Und alles, was man für heute daraus ableiten könnte, überlässt Kosky der Intelligenz des Publikums. ... James Gaffigan hat diese vielschichtige Partitur wirklich ausgeleuchtet bis in die hintersten Winkel. ... Ein kurzweiliges Vergnügen, der Chor - das Rückgrat des Hauses - mal wieder grandios. ... Wer da hingeht, macht nichts falsch!
Premiere an der Komischen Oper »Der goldene Hahn«, Andreas Göbel, rbbKultur
#KOBGoldenerHahn
29. Januar 2024
Barrie Kosky nimmt uns mit in eine düster-romantische Bühnenwelt. Ein Szenario wie von Caspar David Friedrich gemalt. ... Dmitry Ulyanov verkörpert diesen König Dodon in feinster Falstaffmanier als bramarbasierend-donnernder Bass. Die matarihafte Verführerin singt Kseniia Proshina mit schillernd-umgarnendem Sopran, eiskalte Spitzen setzend, in orientalisch-verschlungenen Läufen in der überhaupt klangfarbenreichen Musik Rimsky-Korsakows. ... Die entfaltet das Orchester der Komischen Oper unter der Leitung des neuen Generalmusikdirektors James Gaffigan einfühlsam: von zart-romantisch bis zur überdrehten Farce.
Dystopisches Märchen: »Der Goldene Hahn« an der Komischen Oper, Barbara Wiegand, rbb Inforadio
#KOBGoldenerHahn
26. Januar 2024
Kein einziger schwacher Moment
Der goldene Hahn ist Nikolai Rimski-Korsakows ausgefeilteste und musikalisch farbenprächtigste Oper. Seine meisterhafte Partitur lässt die Geschichte und ihre Figuren sinnlich erleben und schafft es, Erotik nicht nur verführerisch, sondern auch tiefgründig und authentisch klingen zu lassen. Im Gespräch erzählen Dirigent James Gaffigan und Regisseur Barrie Kosky über ein Kind, das einen König spielt, über die Inszenierung eines Deliriums und eine Oper im Gewand einer schwarzen Komödie.
#KOBGoldenerHahn
Interview
1. November 2023
Späte Wiederentdeckung
Ungefähr 10.000 Notenblätter sind im Nachlass des jüdischen Komponisten Hans Winterberg erhalten. Es sind Partituren für rund 80 Werke, darunter Sinfonien und Klavierkonzerte, Klavier- und Kammermusik. Dass diese lange verschollenen Werke nun wieder gespielt und wie nun an der Komischen Oper Berlin sogar uraufgeführt werden, ist seinem Enkel Peter Kreitmeir zu verdanken. Im Interview erzählt er, wie er die Werke entdeckt hat und welche Hürden er nehmen musste, damit die Musik seines Großvaters wieder in Konzertsälen erklingen kann.
#KOBSiKo
Konzert
31. Oktober 2023
Die Maske fällt, es bleibt der Mensch
Schwingende Rhythmen, verführerische Melodien und zauberhaft-surreale Motive ziehen sich durch das erste Sinfoniekonzert der Komischen Oper Berlin in dieser Spielzeit. Nicht zu Unrecht trägt es den Titel Maskenball, denn hinter der tänzelnden, oft mitreißenden Musik verbergen sich Geschichten von versiegter Liebe und unerfüllter Sehnsucht…
#KOBSiKo
Konzert