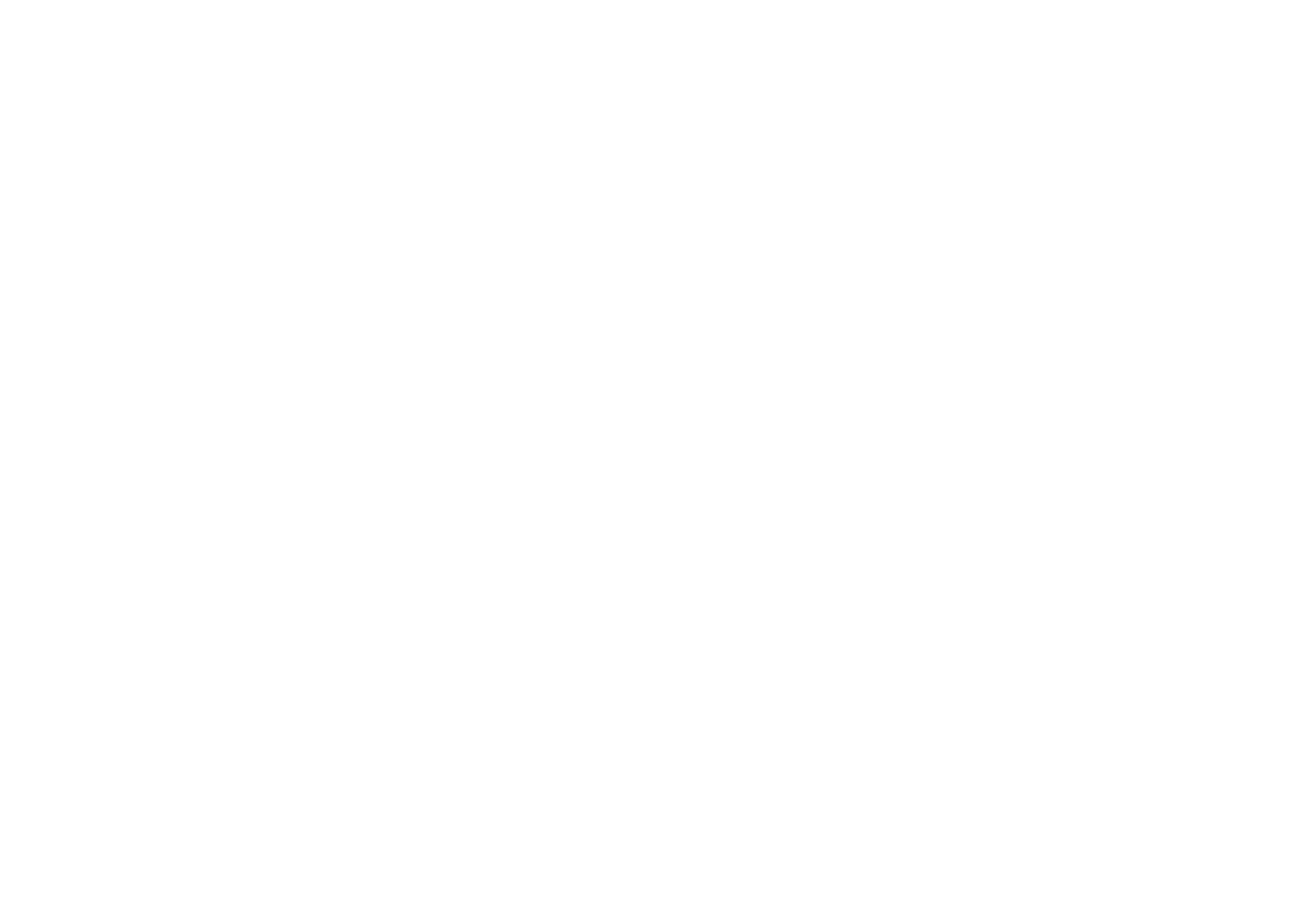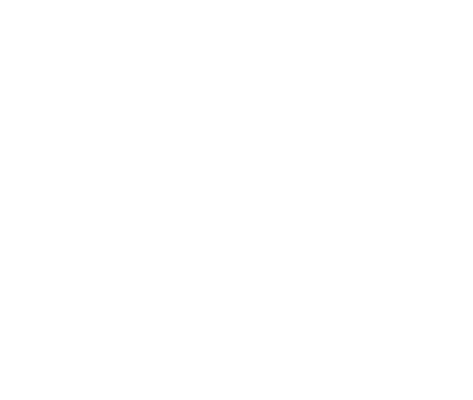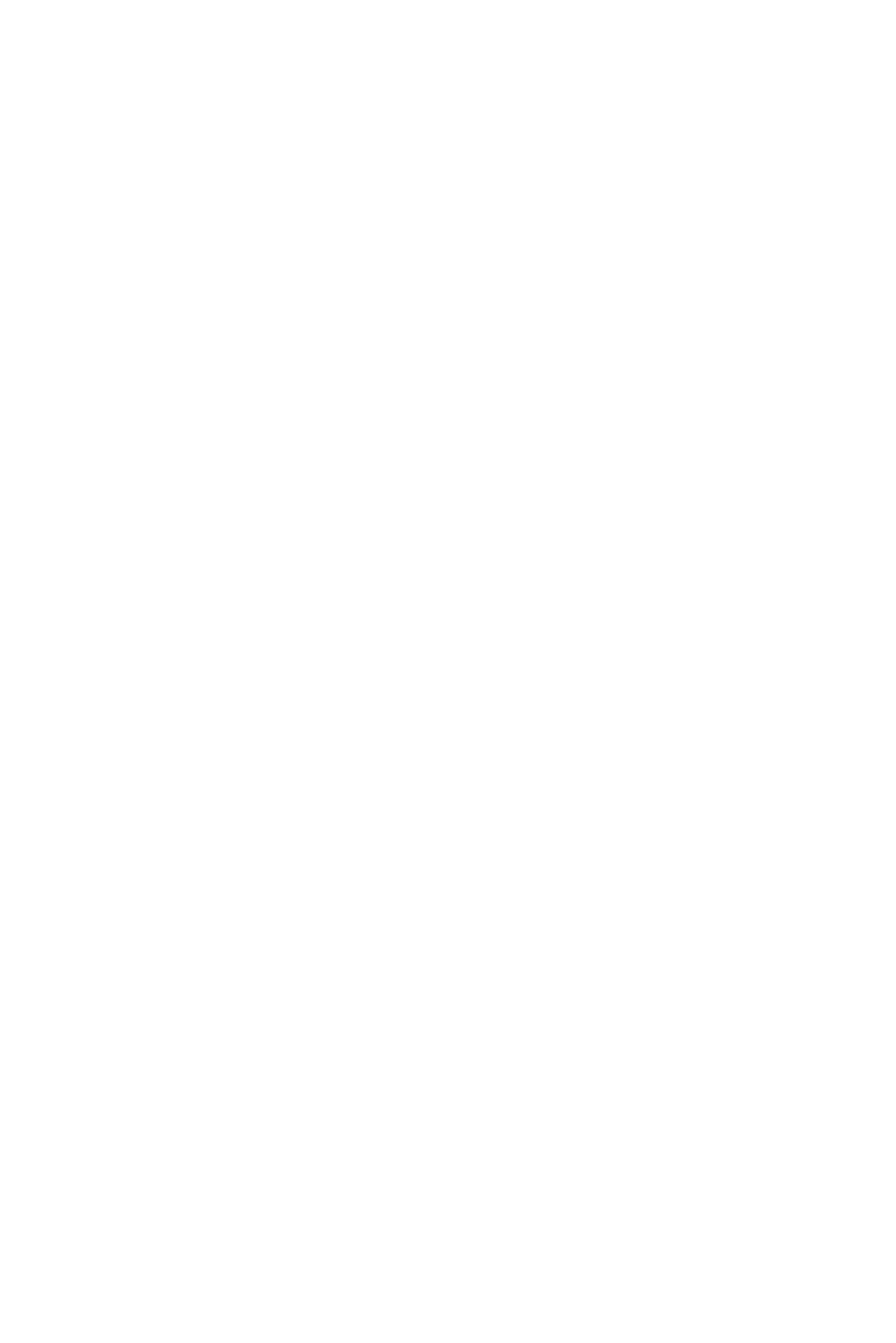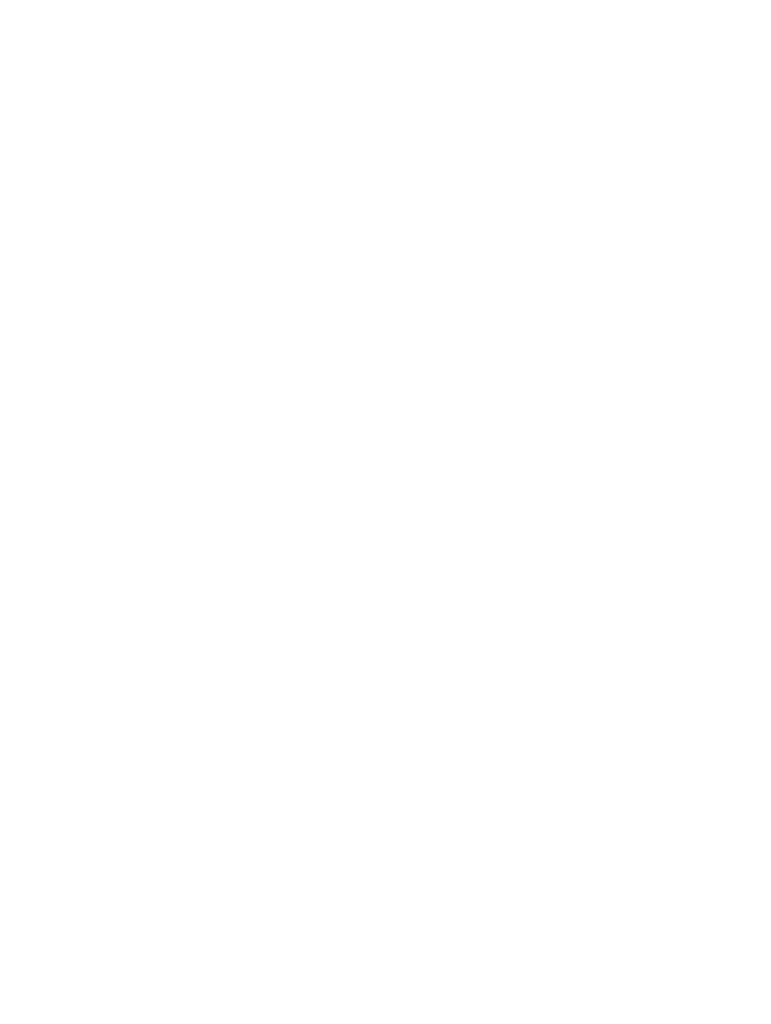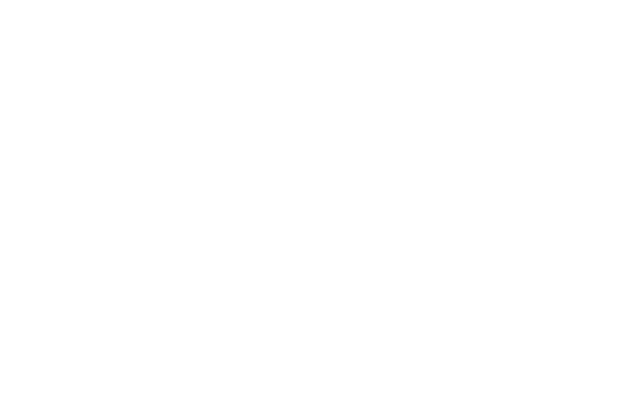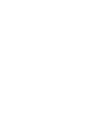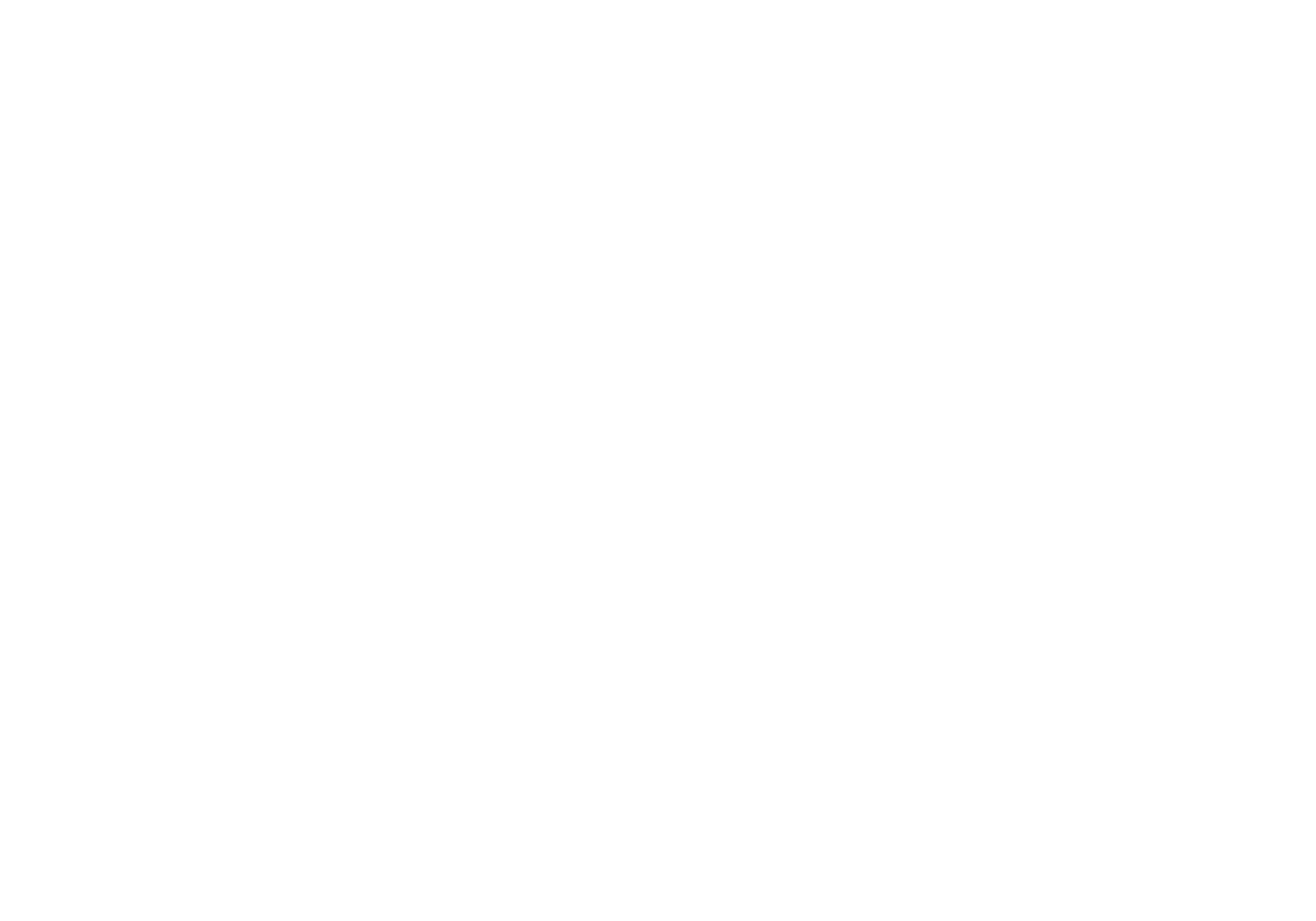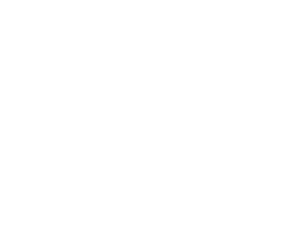© Jan Windszus Photography
Tausend in Tempelhof
Klang des Unbeschreiblichen
1.030 Mitwirkende. Zwei gigantische Aufführungen. Ein Mega-Event der Musikgeschichte. Die Uraufführung von Gustav Mahlers 8. Sinfonie 1910 in München war pure Spektakel-Inszenierung. Doch hinter dem Marketing-Rummel steckt mehr als Größenwahn. Mahler schuf ein tiefes Glaubensbekenntnis. Seine "Sinfonie der Tausend" verbindet den mittelalterlichen Pfingsthymnus "Veni, creator spiritus" mit Goethes Faust-Finale. Bei genauerer Betrachtung offenbart Gustav Mahlers 8. Sinfonie eine existenzielle Botschaft über Erlösung durch göttliche Liebe. Ein Blick hinter die Kulissen eines umstrittenen Meisterwerks.
von Daniel Andrés Eberhard
von Daniel Andrés Eberhard
Von allen Werken Gustav Mahlers bescherte die 8. Sinfonie dem Komponisten bei ihrer Uraufführung den größten Erfolg. Die Begeisterung des Publikums überrascht dabei erstmal wenig, denn Grund zum Jubel gab es am 12. September 1910 allein schon aufgrund der schieren Ausmaße in der Neuen Musik-Festhalle in München: Vor gut 3.200 Menschen spielten laut Ankündigungszettel 171 Personen im Orchester, zwei Chöre mit jeweils 250 Personen, 350 Kinder im Knabenchor sowie acht Gesangssolist:innen. Zählt man hier noch Mahler hinzu, der sein Werk persönlich dirigierte, kommt man auf eine beachtliche Zahl von 1.030 Mitwirkenden – das würde selbst heute noch mühelos als Großspektakel durchgehen. Verständlicherweise war bei diesem Konzert alles anwesend, was damals Rang und Namen hatte: von Komponisten wie Richard Strauss, Arnold Schönberg und Camille Saint-Saëns über die Schriftsteller Thomas Mann, Arthur Schnitzler und Stefan Zweig bis hin zur adeligen Prominenz Prinzessin Gisela von Bayern und Prinz Ludwig Ferdinand. Sie alle wollten sich nicht entgehen lassen, was bereits wochenlang zuvor von der Presse intensiv besprochen und beworben wurde. Bei solch einem Aufwand für lediglich zwei Aufführungen (am 12. und 13. September) lässt sich fraglos nicht mehr von einem gewöhnlichen Sinfoniekonzert sprechen – die Uraufführung von Mahlers Achter war ein gigantisches Event!
Tausend in Tempelhof
Sinfonie Nr. 8 in Es-Dur »Sinfonie der Tausend«
In Kooperation mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin und dem Rundfunkchor Berlin
Aber bitte mit Werbung
Die komplizierte Organisation dieses Events verantwortete der Münchner Konzertveranstalter Emil Gutmann. Dabei bewarb er die Veranstaltung nicht nur mit größtem Einsatz, sondern musste auch immer wieder den exzentrischen Komponisten vor dem Absprung bewahren. Auf Gutmann geht ebenso der Beiname »Sinfonie der Tausend« zurück – eine Anspielung auf die gigantische Besetzung mit werbewirksamer Intention und gerade dadurch in wissenschaftlichen Kreisen gerne belächelt, wenn nicht verhasst. Es wäre allerdings falsch, Gutmann allein für die Eventisierung der 8. Sinfonie verantwortlich zu machen, ging diese doch zu großen Teilen vom Komponisten selbst aus. So belegen Gutmanns Überlieferungen, wie Mahler unter anderem den Bühnenbildner Alfred Roller mit ins Boot holte, um bei der Aufführung für eine ansprechende Optik zu sorgen:
»Die äußere Gruppierung der Massen war ihm [Mahler] sehr wichtig, um auch für das Auge die Einheit des Kunstwerkkörpers sinnfällig zu machen, und Roller […] wußte seinen Absichten durch eine architektonisch höchst wirksame Gliederung in Rumpf und Extremitäten gerecht zu werden. Darüber hinaus noch regelte Mahler die Beleuchtung, ja er setzte sogar durch, daß die Trambahnen, die an der Festhalle entlang rasselten, […] während der […] Aujjührungen langsam und ohne Glockenzeichen vorübergleiten mußten!«
Imposante Choraufstellungen, leise Straßenbahnen und natürlich viel Reklame – nichts wurde hier dem Zufall überlassen. Sinnbildlich für die Marketingstrategien steht nicht zuletzt ein berühmt gewordenes Plakatmotiv von Alfred Roller: Auf beachtlichen 123 x 89,5 Zentimetern wurden die Initialen des Komponisten G M komplementär mit einer römischen Acht dargestellt, wobei die Farbauswahl von Weiß und Orange über dunklem Hintergrund eine Ästhetik zwischen Jugendstil und Moderne Anfang des
20. Jahrhunderts nachempfinden lässt.
»Die äußere Gruppierung der Massen war ihm [Mahler] sehr wichtig, um auch für das Auge die Einheit des Kunstwerkkörpers sinnfällig zu machen, und Roller […] wußte seinen Absichten durch eine architektonisch höchst wirksame Gliederung in Rumpf und Extremitäten gerecht zu werden. Darüber hinaus noch regelte Mahler die Beleuchtung, ja er setzte sogar durch, daß die Trambahnen, die an der Festhalle entlang rasselten, […] während der […] Aujjührungen langsam und ohne Glockenzeichen vorübergleiten mußten!«
Imposante Choraufstellungen, leise Straßenbahnen und natürlich viel Reklame – nichts wurde hier dem Zufall überlassen. Sinnbildlich für die Marketingstrategien steht nicht zuletzt ein berühmt gewordenes Plakatmotiv von Alfred Roller: Auf beachtlichen 123 x 89,5 Zentimetern wurden die Initialen des Komponisten G M komplementär mit einer römischen Acht dargestellt, wobei die Farbauswahl von Weiß und Orange über dunklem Hintergrund eine Ästhetik zwischen Jugendstil und Moderne Anfang des
20. Jahrhunderts nachempfinden lässt.

© Alfred Roller
Plakat von Alfred Roller zur Uraufführung der VIII. Symphonie von Gustav Mahler, 1910
»Symbolische Riesenschwarte«
Stichwort Moderne: Die Frage nach der zukunftsweisenden Qualität des Werkes wurde im Falle von Mahlers 8. Sinfonie von Anbeginn kontrovers diskutiert. Mehr noch als seine vorherigen Werke polarisierte die Achte und erfreute sich im Laufe der Zeit auch zahlreicher Gegner – der prominenteste unter ihnen ist hierbei fraglos Theodor W. Adorno. Das erstaunt insofern, als der ausgewiesene Mahler-Fan Adorno einen wesentlichen Beitrag zur Wiederentdeckung des Komponisten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts leistete. Die 8. Sinfonie war dabei allerdings ein Dorn im Auge des Theoretikers: Zu groß, zu affirmativ, zu viel Es-Dur! Ein tonaler Mahler, ein positiver Mahler, ein größenwahnsinniger Mahler – all das missfiel Adorno, der sich vielmehr für die Zerrissenheit in Mahlers Musik begeisterte. Die »symbolische Riesenschwarte« – wie Adorno die Achte abschätzig nannte – kam hingegen mit kollektiver Erlösungsbotschaft daher, spendete Hoffnung und endete in einer wohlklingenden tonalen Schlussapotheose. Das passte denkbar schlecht mit dem Narrativ zusammen, dass Mahler den Weg zur atonalen Musik geebnet habe. Mahlers Hang zum Spätromantischen wie auch sein Glaube an das Jenseits, in dem der Komponist Lebenssinn und Trost fand, wurden von Adorno offensichtlich ignoriert. Zeitgenossen Mahlers wie etwa der Musikkritiker Ferdinand Pfohl eröffneten hingegen eine Lesart, die die Achte deutlich weniger als Irrweg erscheinen lässt:
»Mahler war Mystiker, Gottsucher. Seine Fantasie kreiste unablässig um die letzten Dinge, um Gott und Welt, um Leben und Tod, Geist und Natur: Jenseits und Unsterblichkeit standen im Mittelpunkt seines Denkens. Tod und Jenseits sind die großen Themen seiner Kunst.«
Mahler selbst bezeichnete seine 8. Sinfonie als »das Größte, was ich je gemacht habe«, wohingegen all seine vorherigen Sinfonien nur »Vorstufen« gewesen seien. Seine Achte ist letztlich ein tiefes Glaubensbekenntnis, fast schon im Sinne einer Kunstreligion à la Richard Wagner. Es verwundert somit kaum, dass ein religiöses Zeugnis – ein christlicher Hymnus – die Initialzündung für das Werk darstellte. 1906 – vier Jahre vor der Uraufführung – stieß Mahler während seines Sommerurlaubes in einem, wie er es selbst nannte, alten »Kirchenschmöker« auf den lateinischen Pfingsthymnus »Veni, creator spiritus«. In mehreren Strophen wird in dem vermutlich um 809 vom Mönch Hrabanus Maurus verfassten Text der Heilige Geist angebetet. Schnell kam Mahler zu dem Entschluss, diesen Hymnus mit der Finalszene aus Johann Wolfgang von Goethes Faust II, der sogenannten »Anachoreten«-Szene, zu kombinieren und daraus eine Sinfonie in zwei Teilen zu machen – eine so unkonventionelle wie streitbare Idee. Denn formal bedeutete dies, dass Mahler die Gattung Sinfonie wie so oft an ihre Grenzen führte. Dass die traditionelle Viersätzigkeit aufgegeben wurde, mag hierbei noch das geringste Problem sein. Die beiden Teile im Längenverhältnis von etwa 1:3 lassen das viersätzige Modell nämlich noch durchaus erkennen. Der Hymnus wäre somit als Kopfsatz in Sonatensatzform zu verstehen, während sich der längere zweite Teil mit der Faust-Szene in die drei Großabschnitte Adagio, Scherzo und Finale unterteilen ließe.
»Mahler war Mystiker, Gottsucher. Seine Fantasie kreiste unablässig um die letzten Dinge, um Gott und Welt, um Leben und Tod, Geist und Natur: Jenseits und Unsterblichkeit standen im Mittelpunkt seines Denkens. Tod und Jenseits sind die großen Themen seiner Kunst.«
Mahler selbst bezeichnete seine 8. Sinfonie als »das Größte, was ich je gemacht habe«, wohingegen all seine vorherigen Sinfonien nur »Vorstufen« gewesen seien. Seine Achte ist letztlich ein tiefes Glaubensbekenntnis, fast schon im Sinne einer Kunstreligion à la Richard Wagner. Es verwundert somit kaum, dass ein religiöses Zeugnis – ein christlicher Hymnus – die Initialzündung für das Werk darstellte. 1906 – vier Jahre vor der Uraufführung – stieß Mahler während seines Sommerurlaubes in einem, wie er es selbst nannte, alten »Kirchenschmöker« auf den lateinischen Pfingsthymnus »Veni, creator spiritus«. In mehreren Strophen wird in dem vermutlich um 809 vom Mönch Hrabanus Maurus verfassten Text der Heilige Geist angebetet. Schnell kam Mahler zu dem Entschluss, diesen Hymnus mit der Finalszene aus Johann Wolfgang von Goethes Faust II, der sogenannten »Anachoreten«-Szene, zu kombinieren und daraus eine Sinfonie in zwei Teilen zu machen – eine so unkonventionelle wie streitbare Idee. Denn formal bedeutete dies, dass Mahler die Gattung Sinfonie wie so oft an ihre Grenzen führte. Dass die traditionelle Viersätzigkeit aufgegeben wurde, mag hierbei noch das geringste Problem sein. Die beiden Teile im Längenverhältnis von etwa 1:3 lassen das viersätzige Modell nämlich noch durchaus erkennen. Der Hymnus wäre somit als Kopfsatz in Sonatensatzform zu verstehen, während sich der längere zweite Teil mit der Faust-Szene in die drei Großabschnitte Adagio, Scherzo und Finale unterteilen ließe.
Gesungene Instrumentalmusik
Als gattungstechnisch weitaus problematischer erweist sich der Einsatz des Gesangs in Mahlers Achter: »Können Sie sich eine Sinfonie vorstellen, die von Anfang bis zu Ende durchgesungen wird?«, fragte der Komponist den befreundeten Musikkritiker Richard Specht. Viele konnten es sich nicht vorstellen und kritisierten am Werk ebenjene Eigenschaft. Und tatsächlich sollte die Frage erlaubt sein, ob es nicht viel eher eine Kantate oder ein Oratorium ist, was uns Mahler da als Sinfonie verkaufen möchte.
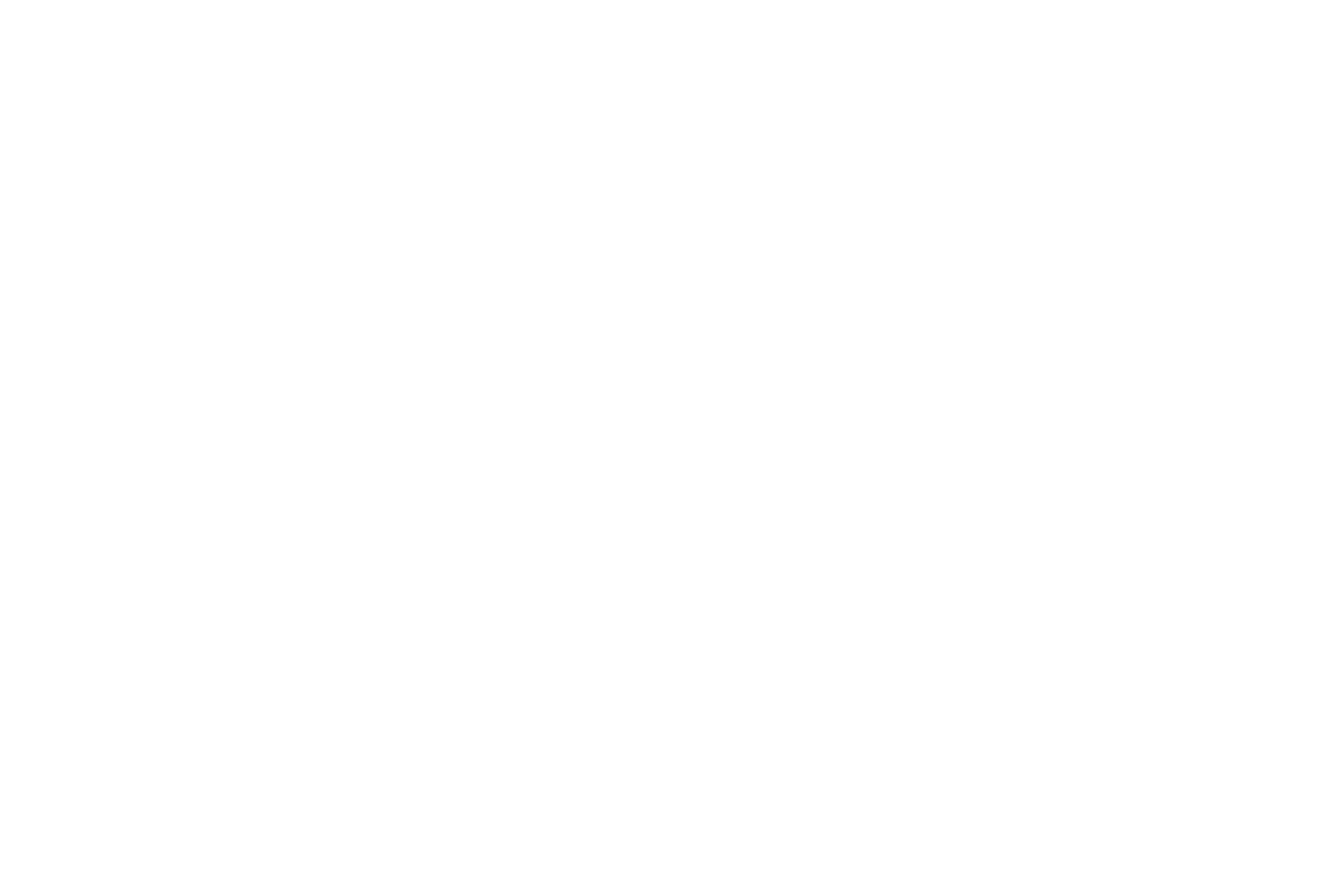
© Jan Windszus Photography
James Gaffigan, Generalmusikdirektor Komische Oper Berlin
Seit Beethovens 9. Sinfonie war der Gesang natürlich nichts Unübliches mehr in der vormals rein instrumentalen Gattung; Mahler ging in seiner Achten allerdings deutlich über dieses Beethoven-Prinzip hinaus. Denn weitaus mehr noch als die Ode an die Freude lädt das Faust-Finale in der nicht szenisch gedachten sinfonischen Gattung zu einer konkreten theatralen Realisierung ein. Dazu kommt noch, dass Mahler sogar die originalen Regieanweisungen von Goethe wortgetreu in seine Partitur übertragen hat. Nun wurde die Uraufführung selbstverständlich nicht szenisch interpretiert, dennoch ermöglicht die Handlung des Goethe-Dramas die Idee eines »unsichtbaren Theaters«, ähnlich wie bei einem Oratorium.
Warum hat Mahler also auf dem Begriff »Sinfonie« bestanden? Letztlich ist die Achte ein Paradebeispiel dafür, wie er die sinfonische Form – inspiriert durch Beethovens Neunte – hin zu einem universalen Gesamtkunstwerk zu öffnen versuchte. Für Mahler konnte die Verschmelzung von Poesie und Wort, instrumentaler und gesungener Musik, nur durch die Sinfonie ausgedrückt werden. Denn die sinfonische Gattung bedeutete für den Komponisten »mit allen Mitteln der vorhandenen Technik eine Welt aufbauen«. Sinfonien mussten für ihn »unerschöpflich wie die Welt und das Leben sein, wenn sie ihres Namens nicht spotten« wollten.
Warum hat Mahler also auf dem Begriff »Sinfonie« bestanden? Letztlich ist die Achte ein Paradebeispiel dafür, wie er die sinfonische Form – inspiriert durch Beethovens Neunte – hin zu einem universalen Gesamtkunstwerk zu öffnen versuchte. Für Mahler konnte die Verschmelzung von Poesie und Wort, instrumentaler und gesungener Musik, nur durch die Sinfonie ausgedrückt werden. Denn die sinfonische Gattung bedeutete für den Komponisten »mit allen Mitteln der vorhandenen Technik eine Welt aufbauen«. Sinfonien mussten für ihn »unerschöpflich wie die Welt und das Leben sein, wenn sie ihres Namens nicht spotten« wollten.
Gewagte Kombi
Umso größere Relevanz erhalten die beiden Texte, die Mahler ausgewählt hat, um seiner Musik eine konkrete Botschaft zu verleihen. Die Kombination von Hymnus und Faust-Finale ist in jedem Fall gewagt: Nicht nur, dass die Texte in unterschiedlichen Sprachen verfasst wurden, ihre Entstehungszeit liegt auch noch gut 1.000 Jahre auseinander. Haben diese Werke demnach überhaupt etwas miteinander zu tun?
Tatsächlich kannte und bewunderte Goethe den Hymnus, mehr noch, er fertigte sogar eine deutsche Dichtfassung (siehe S. 14) an, was Mahler ironischerweise nicht bekannt war. Nun ist dieser Umstand noch kein Beweis dafür, dass der Hymnus Einfluss auf den Faust-Text genommen hat. Offensichtlich ist jedoch, dass sich in der »Anachoreten«-Szene, die die Himmelfahrt der Seele Fausts nach seinem Tod schildert, durchaus Anknüpfungspunkte an den christlichen Erlösungsglauben finden. Eine wesentliche These im Finale von Faust II ist dabei, dass die Erlösung nicht ausschließlich aus eigener Kraft erlangt werden kann, sondern dass es der göttlichen Gnade und Liebe von oben bedarf. Gerade das eröffnet eine Verknüpfung zum Pfingsthymnus, in dem der Heilige Geist Gnade (»Imple superna gratia«) und Liebe (»Infunde amorem cordibus«) spenden soll. In der Faust-Szene singt der Engelchor wiederum:
»Gerettet ist das edle Glied der Geisterwelt vom Bösen:
Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen;
und hat an ihm die Liebe gar von oben teilgenommen, begegnet ihm die sel’ge Schar mit herzlichem Willkommen.«
Mahler hat diese Stelle musikalisch eng mit dem 1. Teil verknüpft. So erklingt zum Text »Accende lumen sensibus. Infunde amorem cordibus« ein Thema in E-Dur, das im 2. Teil bei ebenjener Stelle (»Gerettet ist das edle Glied«) wiederaufgenommen wird. Während der 1. Teil der Sinfonie somit eine kollektive Bitte um Erleuchtung formuliert, bringt der 2. Teil die Erfüllung dieses Wunsches und verhandelt die Prinzipien von göttlicher Gnade und Erlösung am konkreten Beispiel von Fausts geretteter Seele.
Tatsächlich kannte und bewunderte Goethe den Hymnus, mehr noch, er fertigte sogar eine deutsche Dichtfassung (siehe S. 14) an, was Mahler ironischerweise nicht bekannt war. Nun ist dieser Umstand noch kein Beweis dafür, dass der Hymnus Einfluss auf den Faust-Text genommen hat. Offensichtlich ist jedoch, dass sich in der »Anachoreten«-Szene, die die Himmelfahrt der Seele Fausts nach seinem Tod schildert, durchaus Anknüpfungspunkte an den christlichen Erlösungsglauben finden. Eine wesentliche These im Finale von Faust II ist dabei, dass die Erlösung nicht ausschließlich aus eigener Kraft erlangt werden kann, sondern dass es der göttlichen Gnade und Liebe von oben bedarf. Gerade das eröffnet eine Verknüpfung zum Pfingsthymnus, in dem der Heilige Geist Gnade (»Imple superna gratia«) und Liebe (»Infunde amorem cordibus«) spenden soll. In der Faust-Szene singt der Engelchor wiederum:
»Gerettet ist das edle Glied der Geisterwelt vom Bösen:
Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen;
und hat an ihm die Liebe gar von oben teilgenommen, begegnet ihm die sel’ge Schar mit herzlichem Willkommen.«
Mahler hat diese Stelle musikalisch eng mit dem 1. Teil verknüpft. So erklingt zum Text »Accende lumen sensibus. Infunde amorem cordibus« ein Thema in E-Dur, das im 2. Teil bei ebenjener Stelle (»Gerettet ist das edle Glied«) wiederaufgenommen wird. Während der 1. Teil der Sinfonie somit eine kollektive Bitte um Erleuchtung formuliert, bringt der 2. Teil die Erfüllung dieses Wunsches und verhandelt die Prinzipien von göttlicher Gnade und Erlösung am konkreten Beispiel von Fausts geretteter Seele.
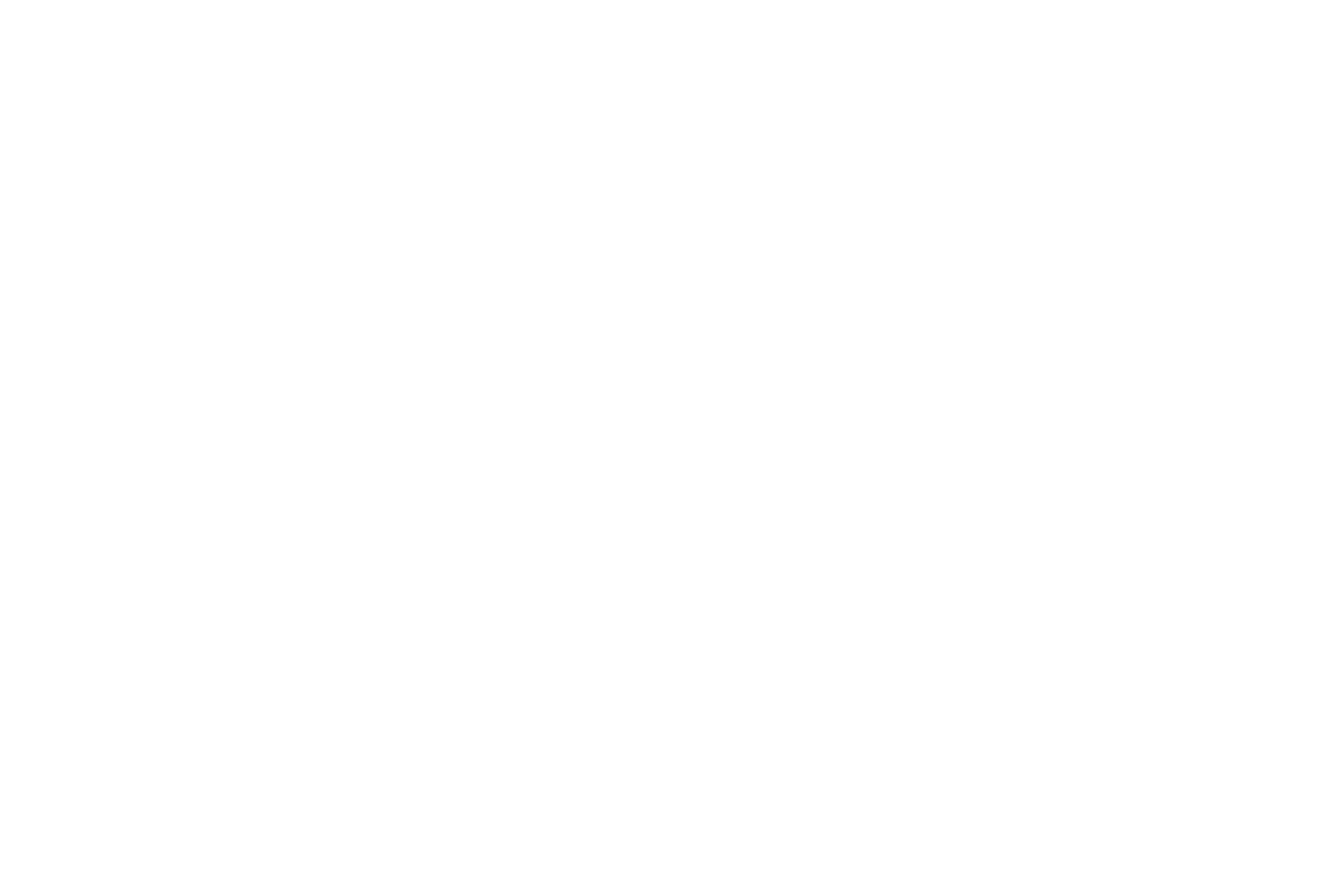
© Jan Windszus Photography
Sinnbildlich für die Erlösung ist die Figur der Mater gloriosa. Nachdem Fausts Seele auf ihrer Reise nach oben verschiedenen Wesen begegnet – unterschiedlich gereiften Engeln, im Kindesalter verstorbenen seligen Knaben, Büßerinnen, ja selbst seiner ehemaligen Geliebten Gretchen – weilt die Mater gloriosa über allem. Doch wer genau ist sie? Maria? Vielleicht sogar Gott selbst? Zu Beginn von Goethes Faust I wurde Gott ja eigentlich noch als »Der Herr« und somit männlich dargestellt. Die Schlussverse des Chorus mysticus lauten nun allerdings:
»Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis; das Unzulängliche, hier wird’s Ereignis; das Unbeschreibliche, hier ist’s getan; das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.«
Es ist faszinierend, wie viel Musik in diesen Versen steckt. Der Sprachkünstler Goethe verdeutlicht hier, wie begrenzt die Sprache letztlich ist, um das »Göttliche« zu beschreiben. Doch wo die Sprache endet, beginnt die Musik. Die Bezeichnung »Chorus« wie auch die Metrik dieser Verse sind Indizien dafür, dass sich Goethe diese Stelle durchaus gesungen vorgestellt haben könnte. »Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis« – Mahler selbst bezog diese Aussage auf die gesamte Faust-Erzählung – das, was also in Faust I und II vorgeführt wurde, sind dem Komponisten zufolge »lauter Gleichnisse«; es sind Worte, die nicht in der Lage sind, das zu umfassen, was den Menschen nach dem Tod erwarten wird. Interessant ist, wie Goethe aufgrund der Begrenztheit des Sprachlich-Fassbaren in den nächsten Versen auf Negationen zurückgriff (»Unzulängliche« / »Unbeschreibliche«), nur um, wie Mahler anmerkte, für sein Fazit wieder auf ein Gleichnis zurückzukommen: »Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan«. Was ist mit dem »Ewig-Weiblichen« gemeint? Szenisch gesehen ist auf die Mater gloriosa zu schließen, die wiederum ein höheres Prinzip repräsentiert. Zu Goethes Zeit wurde das Wort »ewig« mit »göttlich« oder »Gott« assoziiert. Die Quintessenz der Szene ist, dass Faust seine Fehler verziehen werden, und zwar durch die Liebe Gottes. Diese wird personifiziert durch das Weibliche respektive die Mater gloriosa. Eine mögliche Deutung wäre somit, dass das »Ewig-Weibliche« die »Göttliche Liebe« ist.
Das ist es, was uns Mahler in seiner 8. Sinfonie vermitteln möchte: »Veni, creator spiritus« – der Heilige Geist soll kommen. Es ist der Wunsch nach Erlösung durch die Liebe Gottes, die zu Beginn der Sinfonie mit einer der markantesten Melodien, die Mahler komponiert hat, ausgesprochen wird. Am Ende der Sinfonie erklingt das »Veni«-Motiv feierlich im Fernorchester als Zeichen der Erfüllung dieses Wunsches. Es ist verständlich, dass Mahler für diese existenzielle Aussage einen solchen musikalischen Aufwand betrieb. Und ist es nicht letztlich auch eine schöne Aussage? Man wird in jedem Fall anerkennen müssen, dass das Werk – aller Adorno-Kritik zum Trotz – bis heute nichts von seiner überwältigenden Wirkung verloren hat.
»Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis; das Unzulängliche, hier wird’s Ereignis; das Unbeschreibliche, hier ist’s getan; das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.«
Es ist faszinierend, wie viel Musik in diesen Versen steckt. Der Sprachkünstler Goethe verdeutlicht hier, wie begrenzt die Sprache letztlich ist, um das »Göttliche« zu beschreiben. Doch wo die Sprache endet, beginnt die Musik. Die Bezeichnung »Chorus« wie auch die Metrik dieser Verse sind Indizien dafür, dass sich Goethe diese Stelle durchaus gesungen vorgestellt haben könnte. »Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis« – Mahler selbst bezog diese Aussage auf die gesamte Faust-Erzählung – das, was also in Faust I und II vorgeführt wurde, sind dem Komponisten zufolge »lauter Gleichnisse«; es sind Worte, die nicht in der Lage sind, das zu umfassen, was den Menschen nach dem Tod erwarten wird. Interessant ist, wie Goethe aufgrund der Begrenztheit des Sprachlich-Fassbaren in den nächsten Versen auf Negationen zurückgriff (»Unzulängliche« / »Unbeschreibliche«), nur um, wie Mahler anmerkte, für sein Fazit wieder auf ein Gleichnis zurückzukommen: »Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan«. Was ist mit dem »Ewig-Weiblichen« gemeint? Szenisch gesehen ist auf die Mater gloriosa zu schließen, die wiederum ein höheres Prinzip repräsentiert. Zu Goethes Zeit wurde das Wort »ewig« mit »göttlich« oder »Gott« assoziiert. Die Quintessenz der Szene ist, dass Faust seine Fehler verziehen werden, und zwar durch die Liebe Gottes. Diese wird personifiziert durch das Weibliche respektive die Mater gloriosa. Eine mögliche Deutung wäre somit, dass das »Ewig-Weibliche« die »Göttliche Liebe« ist.
Das ist es, was uns Mahler in seiner 8. Sinfonie vermitteln möchte: »Veni, creator spiritus« – der Heilige Geist soll kommen. Es ist der Wunsch nach Erlösung durch die Liebe Gottes, die zu Beginn der Sinfonie mit einer der markantesten Melodien, die Mahler komponiert hat, ausgesprochen wird. Am Ende der Sinfonie erklingt das »Veni«-Motiv feierlich im Fernorchester als Zeichen der Erfüllung dieses Wunsches. Es ist verständlich, dass Mahler für diese existenzielle Aussage einen solchen musikalischen Aufwand betrieb. Und ist es nicht letztlich auch eine schöne Aussage? Man wird in jedem Fall anerkennen müssen, dass das Werk – aller Adorno-Kritik zum Trotz – bis heute nichts von seiner überwältigenden Wirkung verloren hat.
#KOBSiKo
15. Dezember 2025
Neue Chancen, neues Glück
Matthes macht's – so heißt das Neujahrskonzert, das der Schauspieler Ulrich Matthes für die Komische Oper Berlin kuratiert. Von Gershwins pulsierendem Klavierkonzert bis hin zu Arvo Pärts herausfordernder Stille: Matthes Konzertprogramm eröffnet das Neue Jahr mit großer Zuversicht, die Freude und Glück verspricht, Trost spendet und zu einem offenen Blick herausfordert. Ganz so, als würde der seriös-tragische Ernst Heinrich von Kleists auf den Hopsasa-Humor von Louis de Funès treffen. Ein Gespräch über Frühstücksrituale, Großstadtklänge und den Musikgeschmack von Herbert und Monika.
#KOBSiKo
24. November 2025
Wie komponiert man einen Helden?
Über komische Ritter, trunkene Faune und
abwesende Heroen – Eine Einführung zum Sinfoniekonzert Heldenträume.
abwesende Heroen – Eine Einführung zum Sinfoniekonzert Heldenträume.
#KOBSiKo
18. November 2025
Dichter ohne Worte
Von Claude Debussy hat er viel über das Wesen französischer Musik gelernt, von Richard Strauss, wie komplex die Schönheit des Einfachen ist und von Ottorino Respighi, wie Filme ohne Leinwand entstehen – ein Gespräch mit Generalmusikdirektor James Gaffigan über das Sinfoniekonzert Heldenträume und die Kunst sinfonischer Dichtung.
#KOBSiKo
Interview
25. September 2025
Ich glaube, die 8. Sinfonie war Mahlers Liebesbrief, nicht nur an seine Frau Alma, sondern an die ganze Welt. Und in seinen Augen war dies sein wichtigstes Werk. Diese Sinfonie ist wie kosmische Liebe. Das klingt sehr hippiemäßig, als würde ich über Jesus Christ Superstar sprechen. Aber letztendlich geht es in Mahlers Achter darum, das Leben durch Liebe anzunehmen.
James Gaffigan im Gespräch mit Carolin Pirich auf radio3 über monumentale Musik an einem monumentalen Ort und absoluter Hingabe an Gustav Mahlers 'Sinfonie der Tausend'.
#KOBSiKo
10. Februar 2025
Auf der Suche nach einer neuen Klangsprache
Von Feuertänzen, Stürzen und Bizarrerien – eine Einführung zum Sinfoniekonzert Date
#KOBSiKo
#KOBFestival
25. November 2024
Einfach schöne Musik
Ein Gespräch mit Herbert Fritsch über die Leichtigkeit Neuer Musik, die Schönheit chaotischer Rhythmen und mitreißende Spielfreude
#KOBSiKo
10. Juni 2024
Flotte Sohle: Die »Roaring Twenties« und die Melancholie der Welt
Schmissige Rhythmen, nostalgische Melodien und visionäre Techniken: Die Komponisten des Sinfoniekonzerts Flotte Sohle sind durchaus keine Mauerblümchen, nein, sie wagten den Schritt ins kreative Niemandsland und wurden von Zeitgenoss:innen, Parteien, Landsmännern und -frauen sowie Fremden dafür verlacht und verboten. Mutig und entfesselt wagten sie sich aber dennoch aufs Parkett, inspiriert vom Jazz und voller innovativer Ideen, um die Musikwelt zum Tanzen zu bringen! Eine Einführung über visionäre Skandale, surrealistische Filmmusik und einen Totengräber des Tango...
#KOBSiKo
1. Mai 2024
Große Literatur, große Chöre, große Gefühle!
Schauspielerin Laura Balzer erweckt die furchtlose Frauenfigur Antigone in Mendelssohn Bartholdys Schauspielmusik zum Leben.
Unsere Chorsolisten kennen Sie natürlich als unübertroffen wandelbaren und wichtigen Teil unserer Inszenierungen. Im Sinfoniekonzert Antigone erleben Sie sie an diesem Freitag (3. Mai) gemeinsam mit dem Vocalconsort Berlin und dem Orchester der Komischen Oper Berlin unter der Leitung von David Cavelius erstmals konzertant auf der Bühne des Schillertheaters.
Neben Mendelssohn Bartholdys Theatermusik zu Antigone steht auch Schumanns Spanisches Liederspiel auf dem Programm – ein Ohrenschmaus für alle Chorbegeisterten!
Foto Laura Balzer © Stefan Klüter
Unsere Chorsolisten kennen Sie natürlich als unübertroffen wandelbaren und wichtigen Teil unserer Inszenierungen. Im Sinfoniekonzert Antigone erleben Sie sie an diesem Freitag (3. Mai) gemeinsam mit dem Vocalconsort Berlin und dem Orchester der Komischen Oper Berlin unter der Leitung von David Cavelius erstmals konzertant auf der Bühne des Schillertheaters.
Neben Mendelssohn Bartholdys Theatermusik zu Antigone steht auch Schumanns Spanisches Liederspiel auf dem Programm – ein Ohrenschmaus für alle Chorbegeisterten!
Foto Laura Balzer © Stefan Klüter
#KOBSiKo
Chorsolisten
25. April 2024
Geballte Chorpower
Händel, Mozart, Henze, Reimann, Tschaikowski und auch Straus. Ihre Bandbreite ist unglaublich! Nicht umsonst wurden unsere großartigen Chorsolisten mehrmals vom Magazin Opernwelt zum »Opernchor des Jahres« gewählt. Normalerweise erleben Sie sie ebenso munter tanzend wie hochprofessionell spielend. Doch am 3. Mai dreht sich alles um ihre Kernkompetenz: das Singen.
Beim Sinfoniekonzert Antigone steht Sophokles’ 2500 Jahre alter Widerstandstragödie Robert Schumanns Spanisches Liederspiel in einer eigens von Chordirektor David Cavelius arrangierten Fassung gegenüber. Es erwartet Sie ein literarisch-sinfonischer Abend, der die Frage nach der Vereinbarkeit von Eigensinn und Allgemeinwohl stellt.
Foto © Freese/drama-berlin.de
Beim Sinfoniekonzert Antigone steht Sophokles’ 2500 Jahre alter Widerstandstragödie Robert Schumanns Spanisches Liederspiel in einer eigens von Chordirektor David Cavelius arrangierten Fassung gegenüber. Es erwartet Sie ein literarisch-sinfonischer Abend, der die Frage nach der Vereinbarkeit von Eigensinn und Allgemeinwohl stellt.
Foto © Freese/drama-berlin.de
Chorsolisten
Sinfoniekonzert
#KOBSiKo
2. April 2024
Denk ich an Ostdeutschland …
Richard Wagner und Johann Sebastian Bach, Ruth Zechlin und Siegfried Matthus – mit zwei Leipziger Söhnen und zwei DDR-Ikonen begibt sich das Orchester der KOB unter der Leitung von James Gaffigan auf die Spuren ostdeutscher Musikgeschichte!
#KOBSiKo
1. November 2023
Späte Wiederentdeckung
Ungefähr 10.000 Notenblätter sind im Nachlass des jüdischen Komponisten Hans Winterberg erhalten. Es sind Partituren für rund 80 Werke, darunter Sinfonien und Klavierkonzerte, Klavier- und Kammermusik. Dass diese lange verschollenen Werke nun wieder gespielt und wie nun an der Komischen Oper Berlin sogar uraufgeführt werden, ist seinem Enkel Peter Kreitmeir zu verdanken. Im Interview erzählt er, wie er die Werke entdeckt hat und welche Hürden er nehmen musste, damit die Musik seines Großvaters wieder in Konzertsälen erklingen kann.
#KOBSiKo
Konzert
31. Oktober 2023
Die Maske fällt, es bleibt der Mensch
Schwingende Rhythmen, verführerische Melodien und zauberhaft-surreale Motive ziehen sich durch das erste Sinfoniekonzert der Komischen Oper Berlin in dieser Spielzeit. Nicht zu Unrecht trägt es den Titel Maskenball, denn hinter der tänzelnden, oft mitreißenden Musik verbergen sich Geschichten von versiegter Liebe und unerfüllter Sehnsucht…
#KOBSiKo
Konzert