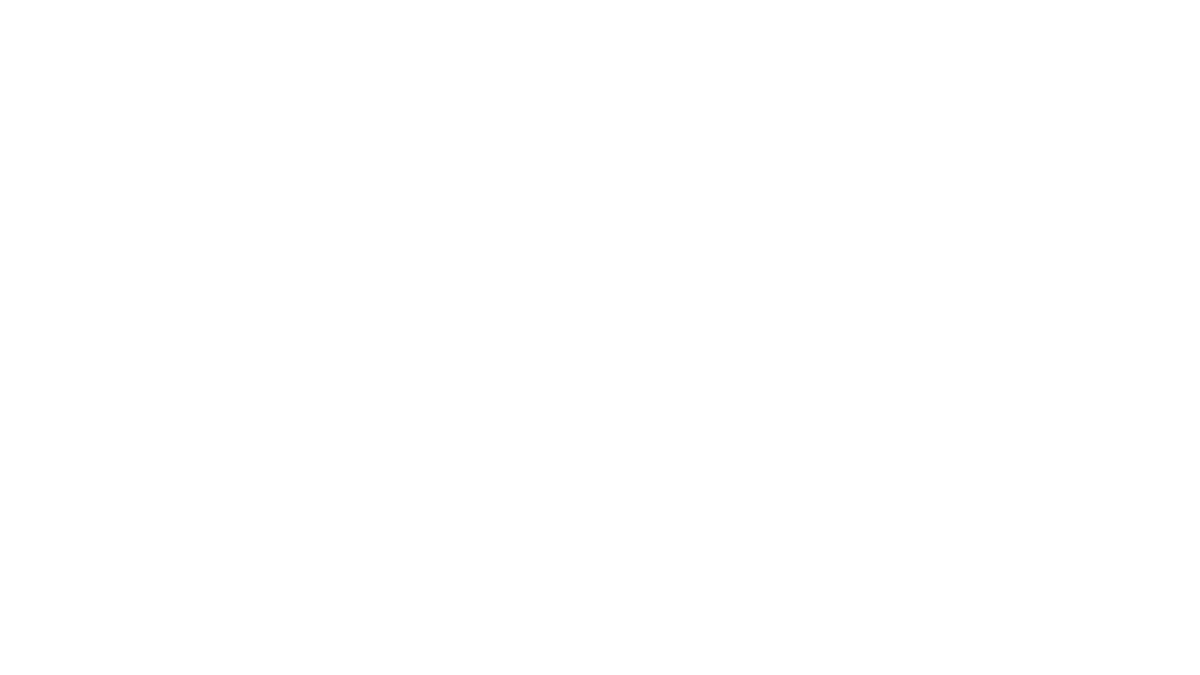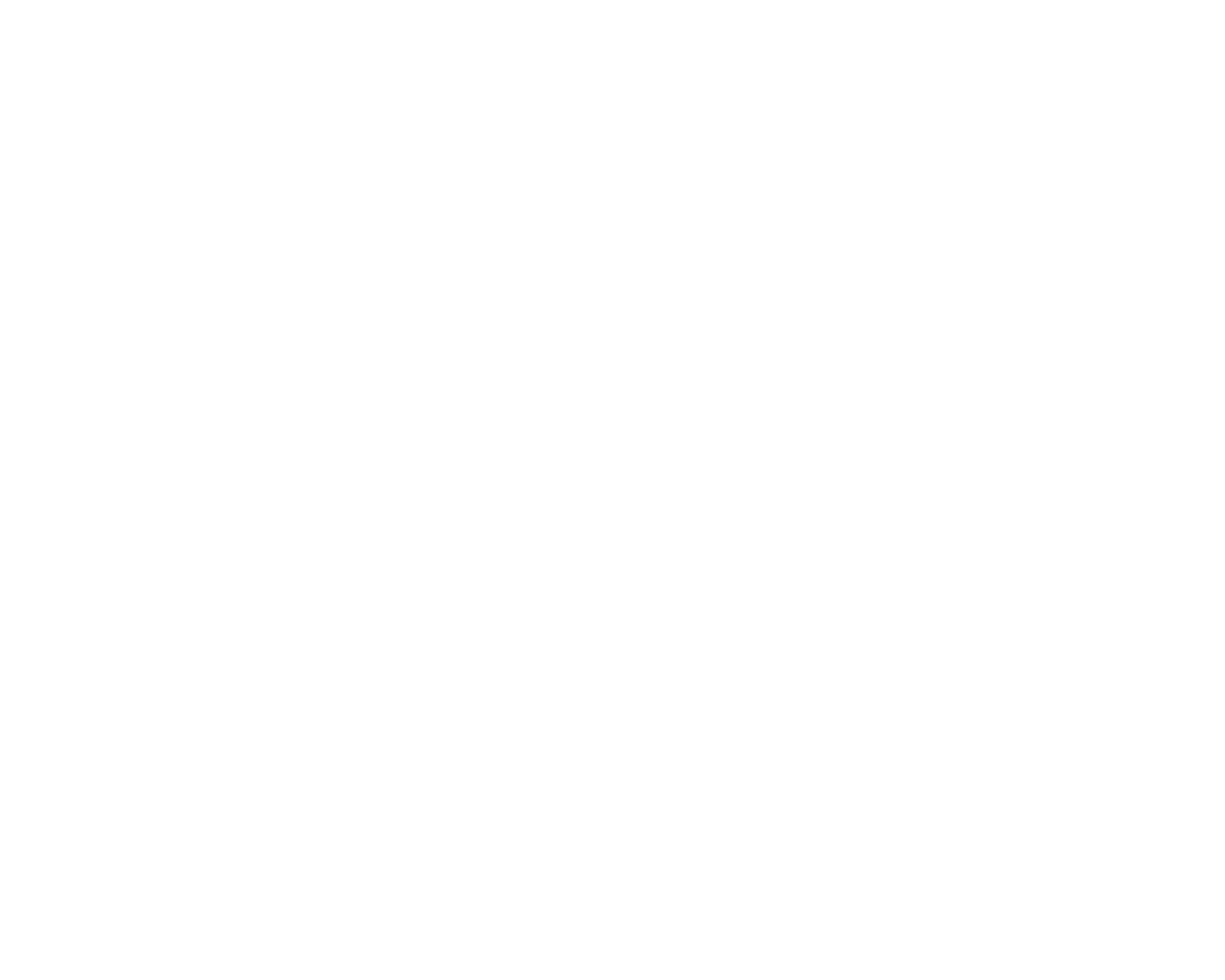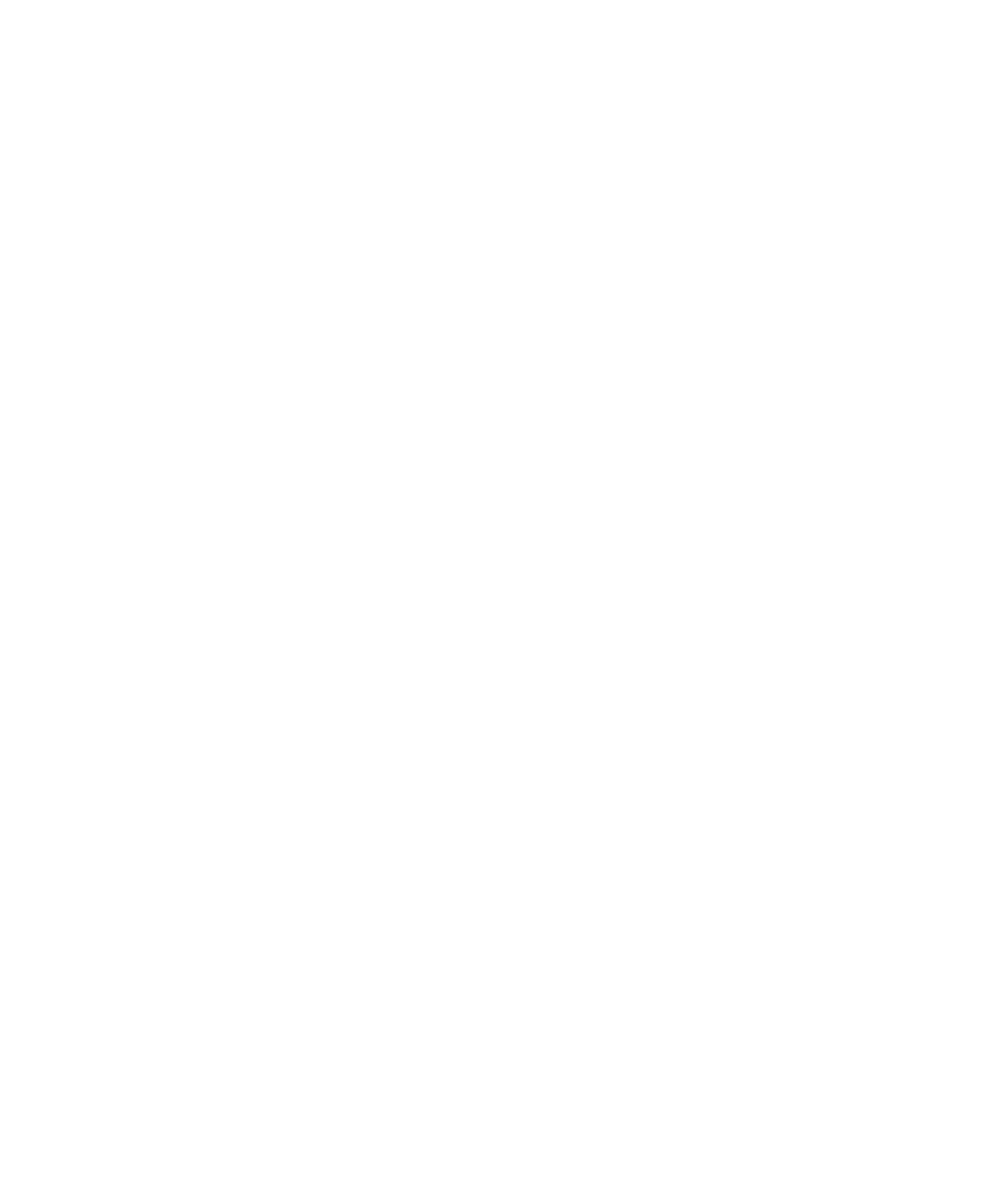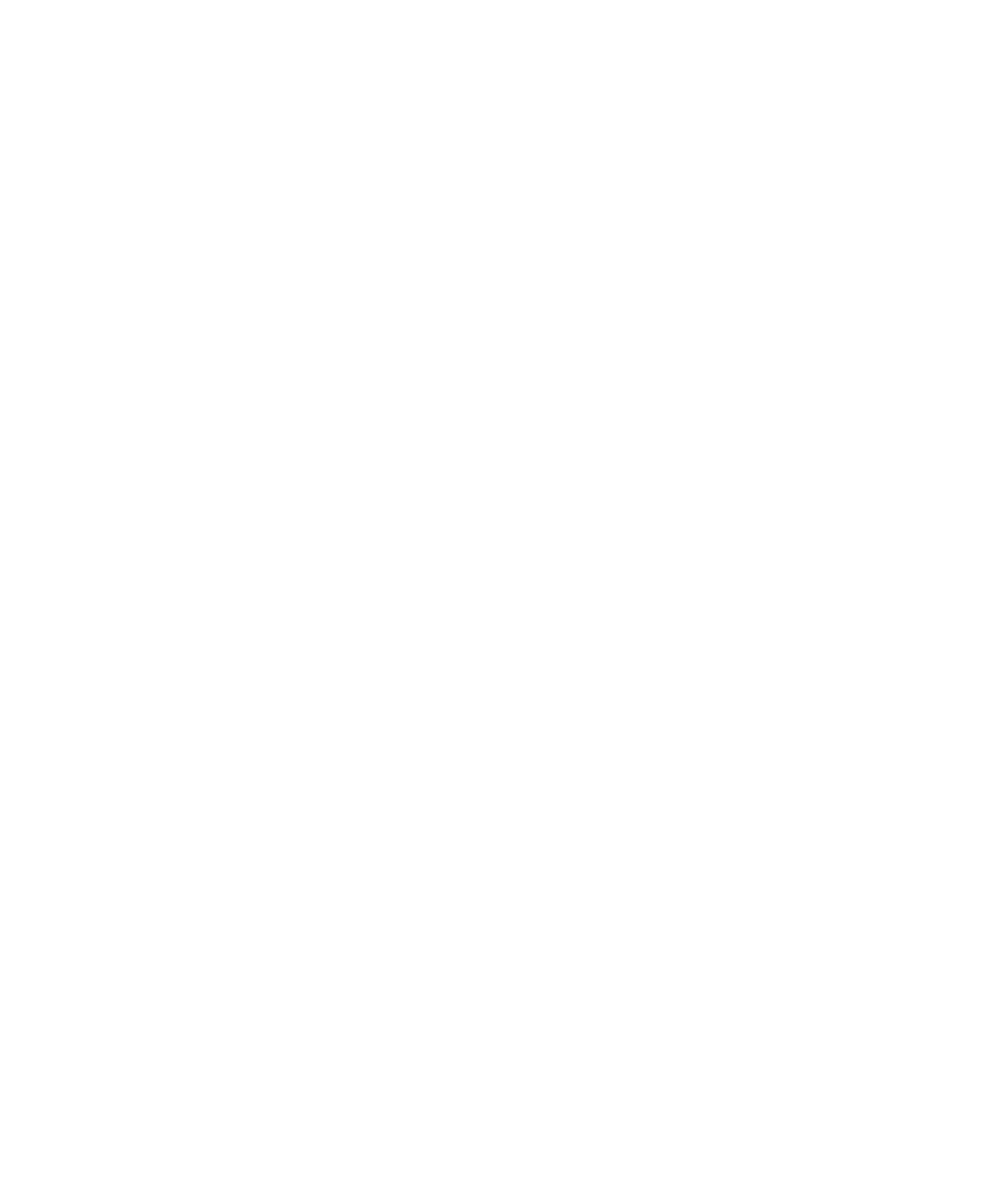Das wahre Drama tobt im Innern
Oder: Warum nur Inkonsequenz uns retten kann
Die Uraufführung von Hercules wurde trotz der mehr als dramatischen Handlung von Lachsalven erschüttert. Und das war nicht das einzige Problem, dem sich Georg Friedrich Händel damals stellen musste. Unsere Chefdramaturgin Johanna Wall schreibt darüber, warum uns manchmal nur die Inkonsequenz retten kann und was dieses Oratorium heute so modern wirken lässt.
An jenem Ort, an dem noch heute das Phantom der Oper durch die Gänge streift, an der Stelle des heutigen His Majesty’s Theatre im Londoner West End erschütterte vor ziemlich genau 279 Jahren schallendes Gelächter das Opernhaus. Der Spott galt Georg Friedrich Händel, der unter dem vormaligen britischen König Georg I. der italienischen Oper auch auf der Insel zu einigem Erfolg verholfen hatte. Genauer gesagt: Man lachte über sein neuestes Oratorium Hercules. Und das war eigentlich alles andere als komisch. Im Sommer davor hatte sich Händel erstmals mit dem Kirchenmann Thomas Broughton zusammengetan, der das Libretto für ein neues Oratorium schreiben sollte. Reverend Broughton (1704–1774) war nicht nur Chorherr an der Kathedrale von Salisbury, er war auch äußerst belesen in weltlichen Dingen. Er übersetzte die revolutionären Schriften Voltaires ins Englische und gab die Werke des Dramatikers John Dryden heraus. Broughtons Herz schlug offensichtlich für Shakespeare – Zitate aus dessen Othello sind im zentralen Eifersuchts-Chor in der Mitte von Hercules zu finden – und für die Musik von Georg Friedrich Händel. Besonders Brougthons psychologisch genaue und für die Zeit geradezu radikale Figurenzeichnung fällt auf, und Händel ging mit seinen kompositorischen Mitteln auf diese frühe Form des psychologischen Realismus ein.
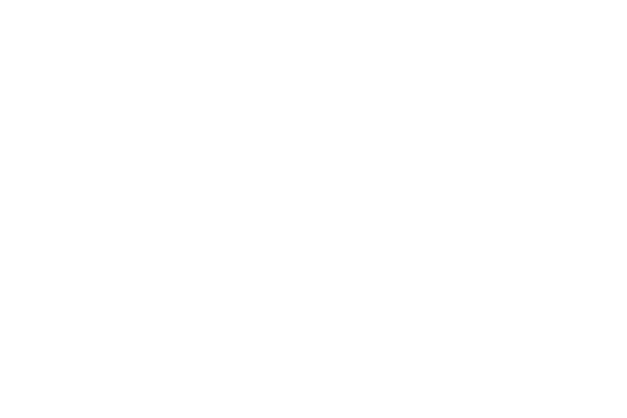
© Monika Rittershaus
Wozu bin ich eigentlich gebeten?
Händel bezeichnete Hercules als »a new musical drama« – Musik-Theater avant la lettre. Und tatsächlich finden sich im Werk, das für keine szenische, sondern eine konzertante Aufführung konzipiert war, Strukturelemente aus gleich drei unterschiedlichen musikdramatischen Gattungen: dem Oratorium, der italienischen Opera seria und der English Opera. Typisch für das Oratorium besticht das Werk durch großartige Chöre, allen voran der Eifersuchts-Chor »Jealousy! Infernal pest« (»Eifersucht, höllische Seuche«) in der Mitte des Stücks. Anders als die italienische Oper wurde das Werk zudem in der Landessprache, also auf Englisch, gesungen. Der Stoff war der antiken Mythologie entnommen, was im Gegensatz zum deutschen Pendant im englischen Oratorium eher die Regel als die Ausnahme bildete. Gleichzeitig nutzte Händel jedoch die für die italienische Opera seria gebräuchliche Form der Arie, die Da-capo-Arie. Daneben komponierte er aber auch neue, eher in der English Opera zu findende Arienformen, die dem strengen Da-capo-Aufbau mit einem ersten A-Teil, einem B-Teil und einem mit Koloraturen reichverzierten A-Teil, der die Melodie des A-Teils wiederholt, nicht mehr folgen. Besonders eindrucksvoll zeigt sich die Auflösung der strikten Form in Dejaniras finaler Wahnsinns-Arie »Where shall I fly«, was nicht von ungefähr geschieht. Im Auseinanderdriften der musikalischen Form macht Händel auf drastische Weise die fortschreitende seelische und geistige Zerrüttung Dejaniras, der von blinder Eifersucht zerfressenen Gattin des Hercules, auf dramatische Weise anschaulich. Vergleichbare Wahnsinns-Arien fanden sich zum damaligen Zeitpunkt, wenn überhaupt, dann in der English Opera. Ein neunzig Jahre jüngeres prominentes Beispiel dieser Arienform bietet Gaetano Donizettis Lucia di Lammermoor. So musikdramatisch ausgefinkelt Hercules auch angelegt ist, das Publikum goutierte den Stilmix nicht. Auf Unerwartetes reagierte es damals wie heute – mit Lachen.
Hercules
Musikalisches Drama in drei Akten [1745]
Georg Friedrich Händel
Libretto von Thomas Broughton
Georg Friedrich Händel
Libretto von Thomas Broughton
Kein günstiges Timing
Gutes Timing – damit war die Uraufiührung von Hercules wahrlich nicht gesegnet. Dass die renommierte Altistin Susanna Maria Cibber, die weniger für eine felsenfeste Gesangstechnik als für ihr außerordentliches Schauspieltalent berühmt war, für die Saison 1745 doch noch zur Verfügung stand, erfuhr Händel viel zu spät. Doch er reagierte prompt: Für die hochgeschätzte Cibber erweiterte er die eigentlich winzige Partie des Boten Lichas und schrieb ihr sechs vollgültige Alt-Arien auf den Leib, Rezitative inklusive. Somit werden Lichas drei musikalische Nummern mehr zuteil als der Titelpartie Hercules. Der Cast für die Uraufiührung war mit Thomas Reinhold als Hercules, Mrs. Robinson (deren Vorname nicht bekannt ist) als Dejanira und Elisabeth Duparc, genannt »La Francesina«, bereits hochkarätig besetzt. Doch der Name der Cibber, zu Lebzeiten die bestbezahlte Schauspielerin (!) Englands, hätte dem Abend die spektakuläre Note verliehen, der es bedurfte, um das anspruchsvolle Hauptstadt-Publikum zu begeistern. Und dann: Stimmprobleme. Frau Cibber musste sich für die Premiere krankmelden. Ein Bote wäre im Normalfall keine so tragende Partie, als dass die Oper nicht ohne ihn hätte stattfinden können. Da die Partie aber inzwischen auf die prominente Sängerin zugeschnitten und dramaturgisch unverzichtbar war, musste eine Lösung her. Gefunden wurde die im Bassisten Gustavus Waltz. Der sollte zwar nicht singen, aber die fürs Verständnis notwendigen überleitenden Rezitativtexte sprechen. Doch Gustavus Waltz war am Premierenabend so heiser, dass das Publikum kein Wort verstand und damit der Handlung nicht folgen konnte. Auf Unverständliches reagierte das Publikum damals wie heute – es lachte.

© Monika Rittershaus
Warum sich der erfahrene Impresario Händel zudem dafür entschieden hatte, die Premiere an einem Samstag stattfinden zu lassen, und nicht wie üblich an einem gewöhnlichen Wochentag, an einem Tag also, an dem parallel »Theaterstücke, Konzerte, Versammlungen, Trommeleien, Hurrikane und der ganze Wahnsinn städtischer Unterhaltung« die Aufmerksamkeit des potenziellen Publikums auf sich zogen, wie es Charles Jennens ausdrückte, bleibt ein Rätsel. Fakt ist: Viele Zuschauer:innen waren es nicht, die während dieser Premiere lachten. Händel setzte das Stück zwar noch einmal an, den ersehnten Erfolg brachte diese (ungestörte) Folgevorstellung aber nicht. Bis heute ist Hercules – mit Ausnahme von Theodora – das wohl am wenigsten populäre Oratorium Händels, das auf seine szenische Erstaufführung 180 Jahre warten musste. Und das trotz eines bis heute durch und durch packenden Plots und einiger der schönsten musikalischen Nummern aus der Feder Georg Friedrich Händels!
Das Werk fängt schlimm an. Hercules Gattin Dejanira ist völlig zermürbt vom Warten auf ihren Ehemann, der seit Jahren auf dem Schlachtfeld Heldentaten vollbringt. Als er zurückkehrt, wirkt er eher erschöpft als siegestrunken. Iole, die Tochter des besiegten und getöteten Königs der Oechalier, hat er als Kriegsbeute verschleppt. Interesse hat er nicht an ihr. Eigentlich müsste Dejanira erleichtert sein, doch die Wiedersehensfreude hält nur für kurze Zeit. Die Eifersucht Dejaniras ist in Broughtons Libretto – anders als im Mythos – völlig unbegründet. Ändern tut das nichts. Dejanira mag wissen, dass Hercules kein amouröses Interesse an der entführten Tochter des besiegten Gegners hat. Glauben kann sie es nicht. Diese innere Zerrissenheit aber ist es, die nicht nur ihr das Leben zur Hölle macht und zugleich das, was sie am meisten ersehnt, verunmöglicht: das Glück mit ihrem geliebten Partner.
Psychologischer Realismus gilt für gewöhnlich als eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts, doch Händels Werk beweist das Gegenteil. Gerade weil das eigentliche Drama in diesem Werk weniger in der äußeren Handlung als im Innenleben der von Händel bis in die Nebenrollen differenziert gezeichneten Charaktere liegt, wirkt Hercules bis heute ungewöhnlich modern.
Das Werk fängt schlimm an. Hercules Gattin Dejanira ist völlig zermürbt vom Warten auf ihren Ehemann, der seit Jahren auf dem Schlachtfeld Heldentaten vollbringt. Als er zurückkehrt, wirkt er eher erschöpft als siegestrunken. Iole, die Tochter des besiegten und getöteten Königs der Oechalier, hat er als Kriegsbeute verschleppt. Interesse hat er nicht an ihr. Eigentlich müsste Dejanira erleichtert sein, doch die Wiedersehensfreude hält nur für kurze Zeit. Die Eifersucht Dejaniras ist in Broughtons Libretto – anders als im Mythos – völlig unbegründet. Ändern tut das nichts. Dejanira mag wissen, dass Hercules kein amouröses Interesse an der entführten Tochter des besiegten Gegners hat. Glauben kann sie es nicht. Diese innere Zerrissenheit aber ist es, die nicht nur ihr das Leben zur Hölle macht und zugleich das, was sie am meisten ersehnt, verunmöglicht: das Glück mit ihrem geliebten Partner.
Psychologischer Realismus gilt für gewöhnlich als eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts, doch Händels Werk beweist das Gegenteil. Gerade weil das eigentliche Drama in diesem Werk weniger in der äußeren Handlung als im Innenleben der von Händel bis in die Nebenrollen differenziert gezeichneten Charaktere liegt, wirkt Hercules bis heute ungewöhnlich modern.

© Monika Rittershaus
Was tun?
Ganz anders als die Helden-Gattin Dejanira verhält sich die Prinzessin der Besiegten, Iole. Sie hätte jeden Grund, jede andere Person im Raum zu hassen. Und das tut sie auch, verachtet und gedemütigt wie sie ist. Und doch schafft sie es zu guter Letzt, über ihren Schatten zu springen. In Hyllus erkennt sie Stück für Stück nicht nur den Spross des Mörders ihres Vaters, sondern jemanden, der von den Taten der Vorväter genauso beschädigt ist wie sie selbst. Und sie reicht ihm die Hand. Vielleicht ist das nicht die große Liebe, das weiß sie wohl. Aber vielleicht der einzige Schritt, der der rasanten Abwärtsspirale etwas entgegensetzen kann. Wissen kann sie es zwar nicht, aber sie darf es glauben.
Mehr dazu
5. Juni 2024
Zingzingzing zingbalabum oder: Offenbachs Operettenwahnsinn
Mit der Operette Die schöne Helena erreichte Jaques Offenbach Weltruhm. Das lag nicht nur an der betörend selbstbewussten und revolutionären Frauenfigur der Helena, die als geistreich witzig und dennoch sexy weltweit die Opernbühnen für sich und damit das Publikum Ende des 19. Jahrhunderts einnahm. Sondern auch an dem gekonnt kunstfertigen Spiel aus Musik und Text, mit denen der Komponist spitzfindig soziale und moralische Normen parodiert – und mit einem antiken Mythos das Sittenbild seiner Zeit als Travestie (über)zeichnet. Die schöne Helena hat die Erfindung der Operette aus der Hand Offenbachs eine weltweiten Siegeszug bereitet, einem Musiktheater, das auf dem Boden von Not und Zensur gewachsen ist – eine Einführung.
#KOBHelena
Einführung
4. März 2024
Dreieinhalb Stunden gehen so schnell vorbei, mit sehr hörenswertem Gesang und einer klugen Regie, die sich keine Deutungshoheit anmaßt, sondern offen lässt, was uns diese Geschichte heute erzählt.
Ein Fest der Stimme: »Hercules« in der Komischen Oper
Barbara Wiegand, rbb24 inforadio
Barbara Wiegand, rbb24 inforadio
4. März 2024
Paula Murrihy Superstar. ... Von der Tanzenden zur Rasenden, vom Hausmuttchen zur Gorgo und zur Furie durchläuft sie alle Stadien weiblicher Tragödie und Zirzensik. Großartig, gerade weil die Sängerin tut, als sei es gar nichts. ...
Mehr als virtuos der Chor der Komischen Oper... Eine seiner besten Leistungen seit Jahren.
Mehr als virtuos der Chor der Komischen Oper... Eine seiner besten Leistungen seit Jahren.
»Hercules« von Georg Friedrich Händel
Kai Luehrs-Kaiser, rbb kultur
Kai Luehrs-Kaiser, rbb kultur
#KOBHercules
27. Februar 2024
Drama, Baby!
Warum Hercules kurz vor der Uraufführung noch einmal so viel länger wurde, als eigentlich geplant und wie aus einem anfänglichen Misserfolg eines der bedeutentsten Werke Händels wurde. Dies und noch viel mehr erfahren Sie in unserem kurzen Überblick.
KOBHercules
Oper
Einführung
3. November 2023
Ein Hoch auf die Nummer zwei!
Der musikalische Leiter Adam Benzwi im Gespräch über linke Hände, die hohe Schule der Travestieclubs und pure Lebensfreude in Barrie Koskys Inszenierung Chicago.
#KOBChicago
31. Oktober 2023
Cherchez Les Femmes!
Das Musical Chicago porträtiert todschicke, mörderisch schlaue und unschlagbar starke Frauen. Sie alle sind keine harmlosen Mäuschen oder hilflose Opfer. Denn sie wissen erfolgreich mit stereotypen Frauenbildern zu spielen und sie für ihre eigenen Interessen zu nutzen. Das Spannende daran: sie alle haben historische Vorbilder. Sehr wahrscheinlich sind sie es auch, die dem True-Crime-Musical Chicago zu seinem Erfolg verhelfen – einer Art Charakterstudie »charmanter Monster«.
#KOBChicago
Musical