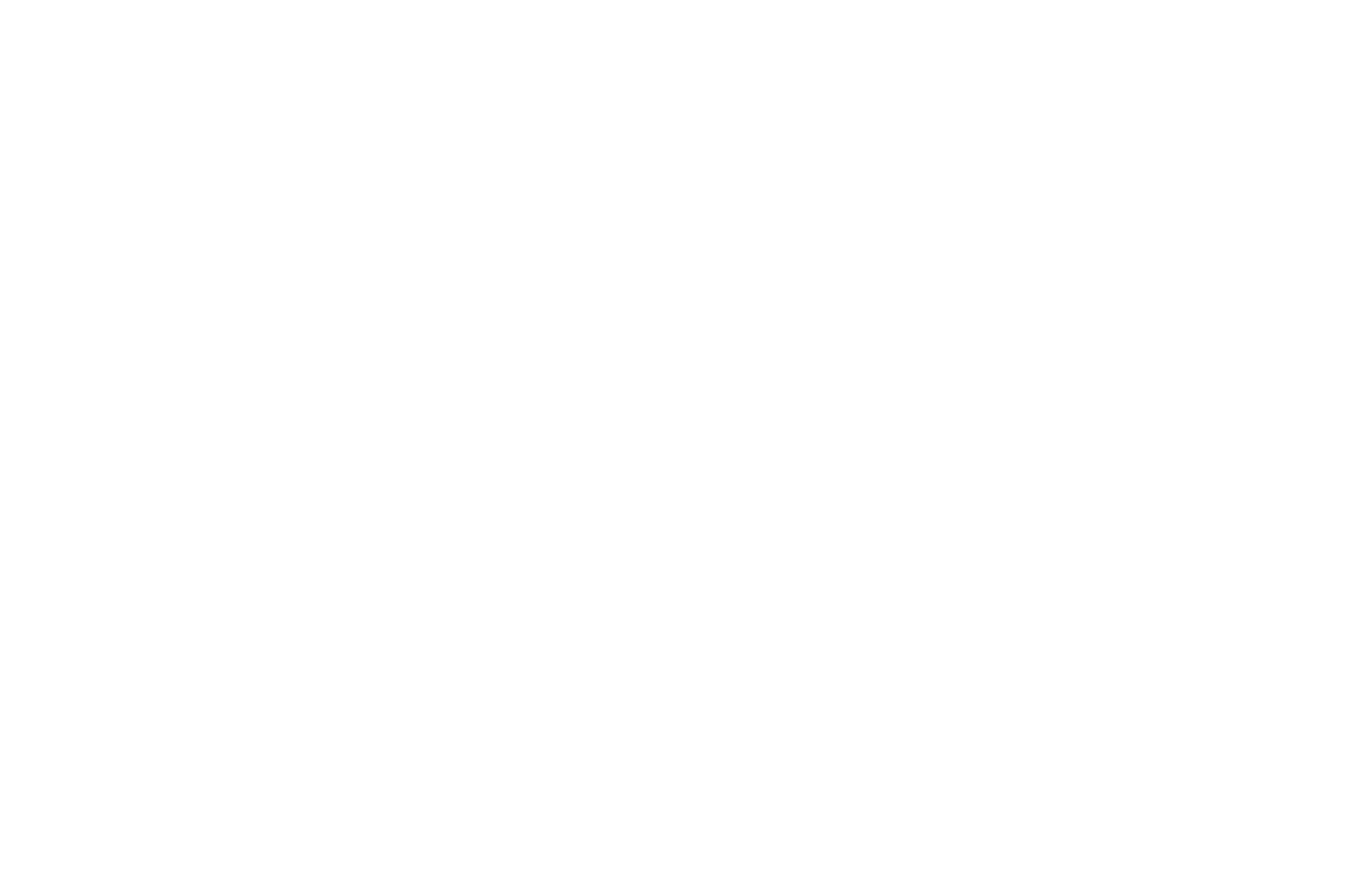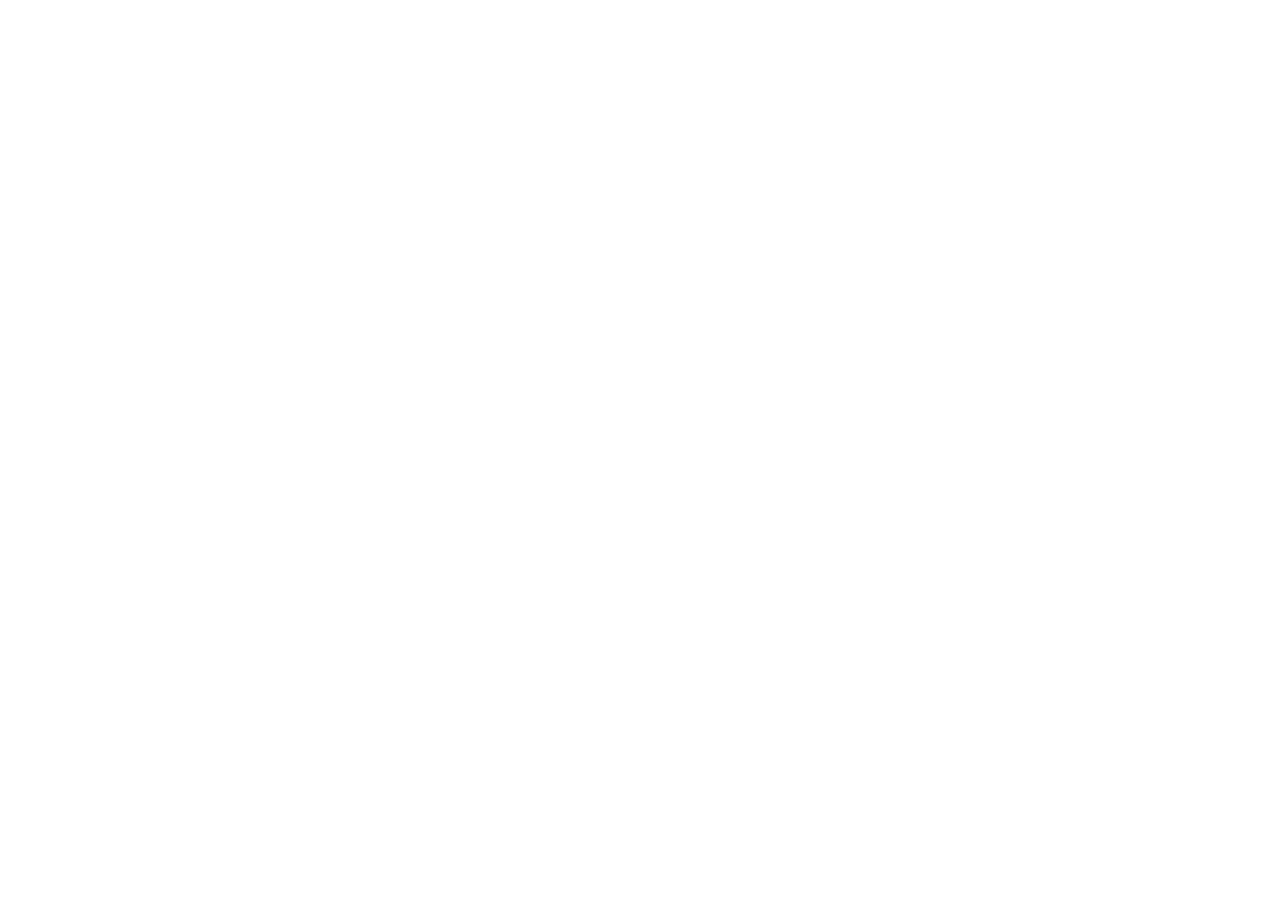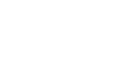© Jaro Suffner
Eine barocke Muppet-Show
Stefan Herheim und Konrad Junghänel im Gespräch über Xerxes
Es ist bei Händels Xerxes fast ein Ding der Unmöglichkeit, die Handlung sinnvoll und verständlich wiederzugeben. Allein der Blick auf das Personal ist verwirrend. Von sieben Figuren sind zwei Frauen, eine als Mann verkleidete Frau und vier Männer, von denen sich einer zumindest zeitweilig als Frau verkleidet. Das alles wird gespielt von fünf Sängerinnen und zwei Sängern. Wie kriegt man das erzählt?
Stefan Herheim Es geht nicht darum, dass man das alles genau verstehen und als logisch empfinden muss. Mozarts
Hochzeit des Figaro ist, was das Verwechslungs- und Verwirrungspotential angeht, insofern viel schlimmer, weil man alles nachvollziehen muss, um das Stück zu verstehen. Bei Xerxes ist das eher eine Setzung, die mit den Konventionen der Barock-Oper zusammenhängt, die den zentralen mächtigen und tragenden Figuren hohe Stimmen zuordnet, während die tiefen männlichen Stimmen den Nebenrollen vorbehalten sind. Wir haben das etwas aufgelockert, indem wir den Diener Elviro zwischen Bariton und Countertenor springen lassen. Bei uns verkleidet er sich nicht als Blumenverkäufer, sondern als Blumenverkäuferin, was eine Referenz an die Spiel-Oper und an Eliza Doolittle aus My Fair Lady oder Figuren aus Berliner Possen ist und die für Xerxes charakteristische Durchmischung von komischem und heroischem Personal direkt verständlich macht. Abgesehen davon interessiert mich natürlich auch der Gender-Aspekt sehr. Was bedeutet das grundsätzlich, wenn eine Frau einen Mann spielt, der dann von einer als Mann verkleideten Frau verführt wird und so weiter. Das liest man heutzutage und mit Freud natürlich auf eine ganz andere Art und Weise als zur Entstehungszeit.
Die Titelfigur war ursprünglich für einen Kastraten geschrieben. Wie geht man heute mit diesem Phänomen um?
Konrad Junghänel Interessant am Kastratenwesen finde ich vor allem den Aspekt, dass die Oper offensichtlich von Anfang an mit dem Star-Wesen verbunden war. Schon bei Monteverdi wurde das Geld für die besten Sänger ausgegeben und dann musste man schauen, wie man den Rest finanziert bekam. Das kristallisierte sich bei Händels italienischen Star-Kastraten besonders heraus. Die Aufgabe, vor der wir heute stehen, ist aber doch viel eher, wie man die Idee umsetzen kann, die musikalisch dahintersteht. Und da ist meines Erachtens überhaupt nicht klar, welche der beiden Besetzungsmöglichkeiten, Countertenor oder Frauenstimme, die adäquatere ist. Was die Kastraten stimmlich vor allem ausgezeichnet hat, ist, dass sie in den hohen Lagen eine immense Kraft entfalten konnten. Diesen Effekt treffen wir heute eher bei Frauenstimmen an. Im Falle von Xerxes ist es bei der Besetzungsfrage ganz entscheidend, die fünf hohen Stimmen, die im Zentrum stehen, mit möglichst unterschiedlichen Stimmcharakteren zu besetzen. Und da haben wir das große Glück, ein tolles facettenreiches Ensemble gefunden zu haben.
Xerxes wurde nur fünfmal gespielt und verschwand dann für fast 200 Jahre von der Bühne. Was ist hier anders als bei anderen Händel-Opern?
Konrad Junghänel Also ehrlich gesagt ist das mit den fünf Aufführungen gar nicht so außergewöhnlich. Und diese geringe Aufführungszahl ist eben nicht zu verwechseln mit einem Qualitätsurteil. Es sind ja nicht die immer die besten Stücke, die erfolgreich sind – und umgekehrt. In den ersten 20, 30 Jahren des 18. Jahrhunderts war die Opera seria die dominierende Form und sie entwickelte ein ziemlich starres formales System aus Rezitativ und Da-capo-Arie. Durch die Dominanz der Arien, die ja durchaus sieben oder acht Minuten dauern konnten, wurde das zu einem relativ handlungsarmen Gebilde. Bei Monteverdi, zu Beginn der Operngeschichte, war das völlig anders. Da gab es eine durchkomponierte dramatische Form, fast schon wie bei Wagner. In theatraler Hinsicht war die Entwicklung der Opera seria also ein Rückschritt, der sich auf die Hits und die Stars kaprizierte. In Xerxes versuchte Händel nun etwas Neues, indem er kleinere formale Einheiten verwendete, dadurch eine größere Kontinuität erzeugte und gleichzeitig auch mehr Möglichkeiten hatte, verschiedene Emotionen miteinander zu konfrontieren. Das hat das Publikum zu der Zeit offensichtlich nicht goutiert.
Stefan Herheim Es geht nicht darum, dass man das alles genau verstehen und als logisch empfinden muss. Mozarts
Hochzeit des Figaro ist, was das Verwechslungs- und Verwirrungspotential angeht, insofern viel schlimmer, weil man alles nachvollziehen muss, um das Stück zu verstehen. Bei Xerxes ist das eher eine Setzung, die mit den Konventionen der Barock-Oper zusammenhängt, die den zentralen mächtigen und tragenden Figuren hohe Stimmen zuordnet, während die tiefen männlichen Stimmen den Nebenrollen vorbehalten sind. Wir haben das etwas aufgelockert, indem wir den Diener Elviro zwischen Bariton und Countertenor springen lassen. Bei uns verkleidet er sich nicht als Blumenverkäufer, sondern als Blumenverkäuferin, was eine Referenz an die Spiel-Oper und an Eliza Doolittle aus My Fair Lady oder Figuren aus Berliner Possen ist und die für Xerxes charakteristische Durchmischung von komischem und heroischem Personal direkt verständlich macht. Abgesehen davon interessiert mich natürlich auch der Gender-Aspekt sehr. Was bedeutet das grundsätzlich, wenn eine Frau einen Mann spielt, der dann von einer als Mann verkleideten Frau verführt wird und so weiter. Das liest man heutzutage und mit Freud natürlich auf eine ganz andere Art und Weise als zur Entstehungszeit.
Die Titelfigur war ursprünglich für einen Kastraten geschrieben. Wie geht man heute mit diesem Phänomen um?
Konrad Junghänel Interessant am Kastratenwesen finde ich vor allem den Aspekt, dass die Oper offensichtlich von Anfang an mit dem Star-Wesen verbunden war. Schon bei Monteverdi wurde das Geld für die besten Sänger ausgegeben und dann musste man schauen, wie man den Rest finanziert bekam. Das kristallisierte sich bei Händels italienischen Star-Kastraten besonders heraus. Die Aufgabe, vor der wir heute stehen, ist aber doch viel eher, wie man die Idee umsetzen kann, die musikalisch dahintersteht. Und da ist meines Erachtens überhaupt nicht klar, welche der beiden Besetzungsmöglichkeiten, Countertenor oder Frauenstimme, die adäquatere ist. Was die Kastraten stimmlich vor allem ausgezeichnet hat, ist, dass sie in den hohen Lagen eine immense Kraft entfalten konnten. Diesen Effekt treffen wir heute eher bei Frauenstimmen an. Im Falle von Xerxes ist es bei der Besetzungsfrage ganz entscheidend, die fünf hohen Stimmen, die im Zentrum stehen, mit möglichst unterschiedlichen Stimmcharakteren zu besetzen. Und da haben wir das große Glück, ein tolles facettenreiches Ensemble gefunden zu haben.
Xerxes wurde nur fünfmal gespielt und verschwand dann für fast 200 Jahre von der Bühne. Was ist hier anders als bei anderen Händel-Opern?
Konrad Junghänel Also ehrlich gesagt ist das mit den fünf Aufführungen gar nicht so außergewöhnlich. Und diese geringe Aufführungszahl ist eben nicht zu verwechseln mit einem Qualitätsurteil. Es sind ja nicht die immer die besten Stücke, die erfolgreich sind – und umgekehrt. In den ersten 20, 30 Jahren des 18. Jahrhunderts war die Opera seria die dominierende Form und sie entwickelte ein ziemlich starres formales System aus Rezitativ und Da-capo-Arie. Durch die Dominanz der Arien, die ja durchaus sieben oder acht Minuten dauern konnten, wurde das zu einem relativ handlungsarmen Gebilde. Bei Monteverdi, zu Beginn der Operngeschichte, war das völlig anders. Da gab es eine durchkomponierte dramatische Form, fast schon wie bei Wagner. In theatraler Hinsicht war die Entwicklung der Opera seria also ein Rückschritt, der sich auf die Hits und die Stars kaprizierte. In Xerxes versuchte Händel nun etwas Neues, indem er kleinere formale Einheiten verwendete, dadurch eine größere Kontinuität erzeugte und gleichzeitig auch mehr Möglichkeiten hatte, verschiedene Emotionen miteinander zu konfrontieren. Das hat das Publikum zu der Zeit offensichtlich nicht goutiert.
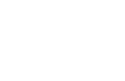
© Jaro Suffner
Der Umgang mit einer so starren musikalischen Form ist sicherlich auch für die szenische Arbeit nicht ganz einfach. Was reizt einen Regisseur an dem Musiktheaterkomponisten Händel?
Stefan Herheim Seine Musik und sein Theater. Es ist wirklich Balsam für die Seele, sich mit einer solchen reinen und gleichzeitig wundervoll dubiosen Partitur auseinanderzusetzen. Ich empfinde barocke Formen wie die Da-capo-Arie gar nicht problematisch. Dass eine Epoche, die die Symmetrie besonders schätzt, die – wie etwa in Versailles – die echten Bäume mit gemalten Bäumen verdeckt, um den absolutistischen Fürsten in das Zentrum der Schöpfung zu stellen, dass eine solche Epoche eine musikalisch so künstliche Form hervorbringt, ist erstmal interessant und nachvollziehbar. Das Zyklische, das Moment der Wiederholung und die Symmetrie sind Bausteine des abendländischen Denkens. Die Spiegelbildlichkeit des Daseins wird in der Musik greifbar gemacht und muss meines Erachtens nicht an sich problematisiert oder aktualisiert werden. Denn obwohl die Formsprache so starr scheint, fordert und erlaubt die musikalische Praxis der Zeit und eben auch die Partitur des Xerxes einen sehr flexiblen Umgang mit dem Material. Diese Flexibilität ist keine Einladung zur Beliebigkeit, sondern dazu, Musikalität zu beweisen. Der scheinbar selbstverständliche Schwung, der von der Dynamik und Struktur dieses Materials ausgeht, ist nichts, was man analytisch festhalten oder greifen könnte. Eher könnte man von einer Urform des Jazz sprechen. Und wenn man diesen Puls nicht spürt oder nicht versteht, wie diese Rhetorik von Händel selbst bereits ironisiert und gebrochen wurde, dann ist man in dieser Welt völlig verloren.
Was bedeutet diese Flexibilität für die musikalische Seite?
Konrad Junghänel Wenn man die Musikgeschichte betrachtet, nimmt der Grad der Freiheit, die man als Dirigent hat, kontinuierlich ab. Wenn man etwa eine Monteverdi-Partitur nimmt, muss man ja erst einmal daran arbeiten, um sie umsetzen zu können. Das ist keine Verdi- oder Wagner-Partitur, in der alles genau drinsteht vom Tempo über die Artikulation bis zur Dynamik. Bei Monteverdi steht gar nichts drin und bei Händel steht noch nicht viel mehr drin. Man muss bei diesen Stücken zwangsläufig nachschöpferisch tätig werden. Zum anderen wissen wir ja auch um die Praxis der damaligen Zeit. Die einzelnen Vorstellungen waren ja nicht identisch. Dass das Publikum durch lautstarke Akklamation die Wiederholung einer Arie einfordern konnte, ist dabei nur das Geringste. Der ganze Umgang mit den Werken war nicht so heilig wie heute. Auch nach einer Premiere wurden durchaus Arien umgestellt oder ausgetauscht. Die Ersatz-Arien konnten gern auch in anderen Sprachen sein. Händel hatte da eine ganze Kiste voller Kompositionen, aus denen er sich bedienen konnte. Das war eine extrem lebendige Theaterpraxis. Ich halte es für vollkommen legitim, sogar für geboten, dass man sich aus dem Material eine eigene Fassung erstellt. Händel wäre sicherlich der Letzte gewesen, der etwas dagegen gehabt hätte.
Stefan Herheim Seine Musik und sein Theater. Es ist wirklich Balsam für die Seele, sich mit einer solchen reinen und gleichzeitig wundervoll dubiosen Partitur auseinanderzusetzen. Ich empfinde barocke Formen wie die Da-capo-Arie gar nicht problematisch. Dass eine Epoche, die die Symmetrie besonders schätzt, die – wie etwa in Versailles – die echten Bäume mit gemalten Bäumen verdeckt, um den absolutistischen Fürsten in das Zentrum der Schöpfung zu stellen, dass eine solche Epoche eine musikalisch so künstliche Form hervorbringt, ist erstmal interessant und nachvollziehbar. Das Zyklische, das Moment der Wiederholung und die Symmetrie sind Bausteine des abendländischen Denkens. Die Spiegelbildlichkeit des Daseins wird in der Musik greifbar gemacht und muss meines Erachtens nicht an sich problematisiert oder aktualisiert werden. Denn obwohl die Formsprache so starr scheint, fordert und erlaubt die musikalische Praxis der Zeit und eben auch die Partitur des Xerxes einen sehr flexiblen Umgang mit dem Material. Diese Flexibilität ist keine Einladung zur Beliebigkeit, sondern dazu, Musikalität zu beweisen. Der scheinbar selbstverständliche Schwung, der von der Dynamik und Struktur dieses Materials ausgeht, ist nichts, was man analytisch festhalten oder greifen könnte. Eher könnte man von einer Urform des Jazz sprechen. Und wenn man diesen Puls nicht spürt oder nicht versteht, wie diese Rhetorik von Händel selbst bereits ironisiert und gebrochen wurde, dann ist man in dieser Welt völlig verloren.
Was bedeutet diese Flexibilität für die musikalische Seite?
Konrad Junghänel Wenn man die Musikgeschichte betrachtet, nimmt der Grad der Freiheit, die man als Dirigent hat, kontinuierlich ab. Wenn man etwa eine Monteverdi-Partitur nimmt, muss man ja erst einmal daran arbeiten, um sie umsetzen zu können. Das ist keine Verdi- oder Wagner-Partitur, in der alles genau drinsteht vom Tempo über die Artikulation bis zur Dynamik. Bei Monteverdi steht gar nichts drin und bei Händel steht noch nicht viel mehr drin. Man muss bei diesen Stücken zwangsläufig nachschöpferisch tätig werden. Zum anderen wissen wir ja auch um die Praxis der damaligen Zeit. Die einzelnen Vorstellungen waren ja nicht identisch. Dass das Publikum durch lautstarke Akklamation die Wiederholung einer Arie einfordern konnte, ist dabei nur das Geringste. Der ganze Umgang mit den Werken war nicht so heilig wie heute. Auch nach einer Premiere wurden durchaus Arien umgestellt oder ausgetauscht. Die Ersatz-Arien konnten gern auch in anderen Sprachen sein. Händel hatte da eine ganze Kiste voller Kompositionen, aus denen er sich bedienen konnte. Das war eine extrem lebendige Theaterpraxis. Ich halte es für vollkommen legitim, sogar für geboten, dass man sich aus dem Material eine eigene Fassung erstellt. Händel wäre sicherlich der Letzte gewesen, der etwas dagegen gehabt hätte.
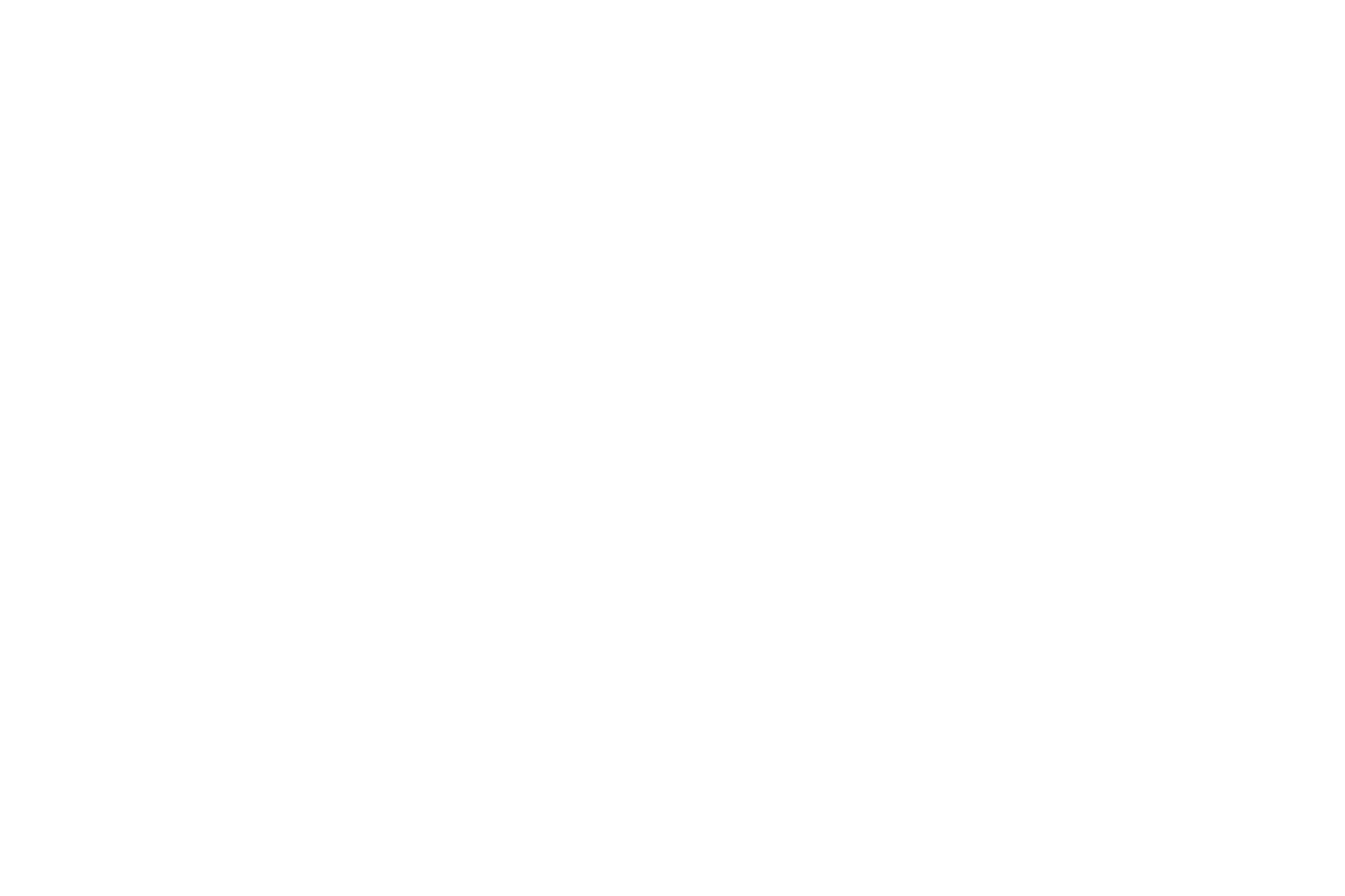
© Jaro Suffner
Man sieht ein barockes Theater auf der Bühne, barocke Kostüme, eine sehr realistische Ausstattung. Handelt es sich bei der Inszenierung um die Rekonstruktion eines Barocktheaters?
Stefan Herheim Es geht uns natürlich nicht um eine originalgetreue Abbildung, sondern um ein Spiel mit Referenzen. Selbst wenn wir es wollten, wäre es unmöglich, eine Aufführung von 1738 zu rekonstruieren. Wir springen zwischen verschiedenen Ebenen, wie in einer barocken Muppet-Show. Unser Ausgangspunkt war zum einen die Überlegung, dass das barocke Welttheater eine Theaterwelt war, die sich vollkommen selbst genügt, zum anderen die Beobachtung, dass die Opera seria bei der Uraufführung von Xerxes eine Form war, die sich in London bereits weitgehend überlebt hatte. Händel war sich dieser Entwicklung bewusst. Ob er mit Xerxes versucht hat, die Oper mit ihrer Fähigkeit, sich über sich selbst lustig zu machen, zu retten, oder ob er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Wirkungsmitteln spielte, so lange es im noch gefüllten Kings’s Theatre am Haymarket überhaupt diese Möglichkeit des Spielens mit den Formen gab – beides ist möglich. Wesentlich ist, dass es für die Figuren ganz existenziell um die Möglichkeit des Spielens geht. Was, wenn die Voraussetzung, Oper zu spielen und zu leben, einfach nicht mehr gegeben ist? Wenn das Publikum wegbleibt, weil die Form nichts mehr leisten kann und niemanden mehr interessiert? Diese Gefahr besteht auch in unserem gegenwärtigen Opernbetrieb. Wir begrenzen uns ja auf ein extrem kleines Repertoire, einen Kanon, den wir ständig neu zu beleben versuchen. Da ist die Opera seria zur Zeit Händels wesentlich spontaner und lebendiger. Es geht mir also nicht darum, unsere Zeit über Händel zu stülpen, sondern Händel über unsere Zeit zu stülpen. So kommen wir zu dem überzeitlich Dekadenten, Redundanten, Nostalgischen und Anachronistischen via die Figuren in diesem Theater, den Sänger, den Kastraten, der seine ganze physische und psychische Existenz dieser Kunstform verschrieben hat, um sich durch, mit und in ihr zu realisieren. Soll er die Bühnenwelt beherrschen, muss er König einer Weltbühne sein. Was aber, wenn dieses System seine Gültigkeit verliert? Die damit verbundene Leere und Ohnmacht kommt einer existenziellen Krise gleich, die wiederum viel mit unserer Gegenwart zu tun hat – weit außerhalb des Opernbetriebs. Das Theater, in dem unser Xerxes spielt, ist zwar anscheinend ein realistischer Raum, letztlich aber auch nur eine Kulisse, die wir auf die Bühne der Komischen Oper Berlin stellen für ein Spiel von Spielern, die sich im Laufe des Abends leidenschaftlich erschöpfen. Wir lieben sie dafür, dass sie unsere eigene Leere füllen.
Stefan Herheim Es geht uns natürlich nicht um eine originalgetreue Abbildung, sondern um ein Spiel mit Referenzen. Selbst wenn wir es wollten, wäre es unmöglich, eine Aufführung von 1738 zu rekonstruieren. Wir springen zwischen verschiedenen Ebenen, wie in einer barocken Muppet-Show. Unser Ausgangspunkt war zum einen die Überlegung, dass das barocke Welttheater eine Theaterwelt war, die sich vollkommen selbst genügt, zum anderen die Beobachtung, dass die Opera seria bei der Uraufführung von Xerxes eine Form war, die sich in London bereits weitgehend überlebt hatte. Händel war sich dieser Entwicklung bewusst. Ob er mit Xerxes versucht hat, die Oper mit ihrer Fähigkeit, sich über sich selbst lustig zu machen, zu retten, oder ob er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Wirkungsmitteln spielte, so lange es im noch gefüllten Kings’s Theatre am Haymarket überhaupt diese Möglichkeit des Spielens mit den Formen gab – beides ist möglich. Wesentlich ist, dass es für die Figuren ganz existenziell um die Möglichkeit des Spielens geht. Was, wenn die Voraussetzung, Oper zu spielen und zu leben, einfach nicht mehr gegeben ist? Wenn das Publikum wegbleibt, weil die Form nichts mehr leisten kann und niemanden mehr interessiert? Diese Gefahr besteht auch in unserem gegenwärtigen Opernbetrieb. Wir begrenzen uns ja auf ein extrem kleines Repertoire, einen Kanon, den wir ständig neu zu beleben versuchen. Da ist die Opera seria zur Zeit Händels wesentlich spontaner und lebendiger. Es geht mir also nicht darum, unsere Zeit über Händel zu stülpen, sondern Händel über unsere Zeit zu stülpen. So kommen wir zu dem überzeitlich Dekadenten, Redundanten, Nostalgischen und Anachronistischen via die Figuren in diesem Theater, den Sänger, den Kastraten, der seine ganze physische und psychische Existenz dieser Kunstform verschrieben hat, um sich durch, mit und in ihr zu realisieren. Soll er die Bühnenwelt beherrschen, muss er König einer Weltbühne sein. Was aber, wenn dieses System seine Gültigkeit verliert? Die damit verbundene Leere und Ohnmacht kommt einer existenziellen Krise gleich, die wiederum viel mit unserer Gegenwart zu tun hat – weit außerhalb des Opernbetriebs. Das Theater, in dem unser Xerxes spielt, ist zwar anscheinend ein realistischer Raum, letztlich aber auch nur eine Kulisse, die wir auf die Bühne der Komischen Oper Berlin stellen für ein Spiel von Spielern, die sich im Laufe des Abends leidenschaftlich erschöpfen. Wir lieben sie dafür, dass sie unsere eigene Leere füllen.
Mehr dazu
9. September 2022
Bruchstücke der Erinnerung
Barrie Kosky und Konrad Junghänel über verbotene Fragen, zersplitterte Spiegel und das, was bleibt.
#KOBSemele
Oratorium
Interview
13. Februar 2023
Phönix aus der Asche
Händels Werk Semele vereint das Beste aus italienischer Oper und englischem Oratorium. Lesen Sie, wie Händel der ursprünglichen Komödie Tiefe verlieh und sein Spiel mit musikalischen Formen die Handlung plastisch für Auge und Ohr vorführt.
#KOBSemele
Einführung
Oratorium