© Monika Rittershaus
Realer als real
Brutal und respektlos regiert König Dodon sein Reich, machttrunken ohne Verantwortungsbewusstsein. Er ist blind für seine eigene Menschlichkeit und damit auch für seine Lächerlichkeit. Denn so abgründig getrieben von Ängsten und Sehnsüchten der willfährige Herrscher in Der goldene Hahn gezeichnet wird, so entlarvend, komisch und hintergründig ist die Oper aus der Hand des russischen Komponisten Nikolai Rimski-Korsakows. Ein musikalisches Meisterwerk über notwendige Widersprüche. Von Olaf A. Schmidt
»Ich will tapfer sterben: wie ein schmucker Bräutigam. Wie! Ich will heiter sein: kommt, kommt; ich bin ein König, ihr Herren, wisst ihr das?« In Widerspruch, Unberechenbarkeit, Jähzorn, Mitleid verstrickt sich William Shakespeares König Lear, ein gealterter Herrscher, der an seiner Macht festhält und gleichzeitig von ihr in Ruhe gelassen werden möchte. König Dodon möchte schlafen und glaubt dennoch, Krieg führen zu müssen. Eine »unglaubliche Geschichte« nannte Nikolai Rimski-Korsakow seine letzte Oper Der goldene Hahn gegenüber dem Librettisten, doch Spuren zu realen politischen Ereignissen der Entstehungszeit lassen sich darin leicht finden. Als »Märchen« ist die Vorlage von Alexander Puschkin bezeichnet und enthüllt gerade dadurch ihre grausame Relevanz. Den Komponisten inspirierte diese scheinbar paradoxe Situation: »Es wird sich in der Welt wohl kaum jemand finden, der weniger an alles Übernatürliche, Phantastische oder auch hinter der Todesgrenze Liegende glaubt als ich, und dennoch liebe ich als Künstler alles das am meisten«, bekannte er gegenüber Wassili Jastrebzew, der ihm jahrzehntelang freundschaftlich verbunden war und seine Erinnerungen aufschrieb.
Shakespeares greiser König beschäftigte Rimski-Korsakow bereits im Alter von 17 Jahren, als in Mili Balakirews Kreis dessen Schauspielmusik zu König Lear am Klavier erklang. 1861 wurde er in die Gruppe um diesen Komponisten aufgenommen, wo die neuesten Kompositionen, unter anderem von Modest Mussorgski, teilweise mehrhändig am Klavier gespielt wurden. Obwohl Balakirew den jungen Musiker zum Schreiben seiner ersten Symphonie ermunterte, hätte dieser am liebsten zunächst das kompositorische Handwerk gelernt. Doch das beherrschte selbst sein Mentor nicht, wie Rimski-Korsakow in der Chronik meines musikalischen Lebens schreibt:
Dazu war er nicht in der Lage, denn er hatte diese Fächer ja selbst nie systematisch betrieben und hielt sie für entbehrlich

© Monika Rittershaus
Dieser Mangel an solider Ausbildung ließ Rimski-Korsakow zehn Jahre später, 1871, beinahe das Angebot einer Professur für Komposition und Instrumentation am Konservatorium in St. Petersburg ausschlagen: »Vom ersten Augenblick an war ich mir darüber klar, dass ich keinerlei Vorbildung für die angebotene Tätigkeit mitbrachte, und deshalb bat ich mir zunächst Bedenkzeit aus.« Er entschied sich schließlich dafür und prägte so in den folgenden Jahrzehnten einen Teil der europäischen Musikgeschichte: Zu seinen Schülern gehörten neben anderen Alexander Glasunow, Igor Strawinski und Sergei Prokofjew.
Seine eigenen Kompositionen kennzeichnet eine ungeheure stilistische Vielfalt, die wohl auch aus der mangelnden musikalischen Ausbildung erwuchs. Daran litt er selbst am meisten, was ihn jedoch die Werke seiner Vorgänger und Zeitgenossen geradezu in sich aufsaugen ließ. In einzigartiger Weise verbindet Rimski-Korsakows Musik ästhetische Vorstellungen der Jahrzehnte vor seinen eigenen Werken mit Impulsen für nachfolgende Komponistengenerationen. Gerade bei seiner letzten Oper sind diese Impulse mit der komplexen Rezeptionsgeschichte des Werks verwoben. Erst nach seinem Tod in einer zensierten Fassung in Russland uraufgeführt, erlangte Der goldene Hahn europäische Aufmerksamkeit durch die Aufführung von Sergei Djagilews Ballets russes 1914 in Paris, wo die Sänger:innen quasi konzertant von der Seite sangen, während Tänzer:innen die Handlung auf der Bühne erzählten. Dieser Inszenierungsstil des Choreographen Michail Fokin sollte wiederum Igor Strawinski, dessen Le sacre du printemps 1913 den größten Theaterskandal für die Balletttruppe bedeutete, zu weiteren Werken wie Le rossignol, L’histoire du soldat und Les noces inspirieren. So sehr die auch in London gezeigte Aufführung der internationalen Verbreitung von Rimski-Korsakows letzter Oper half, wehrten sich seine Familie und auch der Librettist Wladimir Belski dennoch gegen diese in ihren Augen zu große Vereinnahmung der Oper durch den Tanz. Auf die Rezeption von Rimski- Korsakows Werk insgesamt in seiner Heimat konnte Belski keinen Einfluss mehr nehmen. Wie zahlreiche Natur- und Geisteswissenschaftler, die teilweise dem Komponisten nahestanden und sich um die Interpretation seiner Werke bemühten, verließ auch Belski in den Jahren um 1920 unter dem Regime von Wladimir Lenin das Land. »Die Deutungshoheit über Rimski-Korsakows Schaffen fiel sowjetrussischen Interpreten zu«, schreibt die Musikwissenschaftlerin und Dramaturgin Sigrid Neef: »In Wort wie aufführungspraktischer Tat wurde Rimski-Korsakow zum Schilderer altrussischer Sitten und heidnischen Brauchtums gemacht. Unter prächtigen Kostümen, unter Kaftan und Sarafan erstickten die Figuren, und an die Stelle von lebendigen Gestalten traten folkloristisch aufgeputzte Opernsänger.«
Seine eigenen Kompositionen kennzeichnet eine ungeheure stilistische Vielfalt, die wohl auch aus der mangelnden musikalischen Ausbildung erwuchs. Daran litt er selbst am meisten, was ihn jedoch die Werke seiner Vorgänger und Zeitgenossen geradezu in sich aufsaugen ließ. In einzigartiger Weise verbindet Rimski-Korsakows Musik ästhetische Vorstellungen der Jahrzehnte vor seinen eigenen Werken mit Impulsen für nachfolgende Komponistengenerationen. Gerade bei seiner letzten Oper sind diese Impulse mit der komplexen Rezeptionsgeschichte des Werks verwoben. Erst nach seinem Tod in einer zensierten Fassung in Russland uraufgeführt, erlangte Der goldene Hahn europäische Aufmerksamkeit durch die Aufführung von Sergei Djagilews Ballets russes 1914 in Paris, wo die Sänger:innen quasi konzertant von der Seite sangen, während Tänzer:innen die Handlung auf der Bühne erzählten. Dieser Inszenierungsstil des Choreographen Michail Fokin sollte wiederum Igor Strawinski, dessen Le sacre du printemps 1913 den größten Theaterskandal für die Balletttruppe bedeutete, zu weiteren Werken wie Le rossignol, L’histoire du soldat und Les noces inspirieren. So sehr die auch in London gezeigte Aufführung der internationalen Verbreitung von Rimski-Korsakows letzter Oper half, wehrten sich seine Familie und auch der Librettist Wladimir Belski dennoch gegen diese in ihren Augen zu große Vereinnahmung der Oper durch den Tanz. Auf die Rezeption von Rimski- Korsakows Werk insgesamt in seiner Heimat konnte Belski keinen Einfluss mehr nehmen. Wie zahlreiche Natur- und Geisteswissenschaftler, die teilweise dem Komponisten nahestanden und sich um die Interpretation seiner Werke bemühten, verließ auch Belski in den Jahren um 1920 unter dem Regime von Wladimir Lenin das Land. »Die Deutungshoheit über Rimski-Korsakows Schaffen fiel sowjetrussischen Interpreten zu«, schreibt die Musikwissenschaftlerin und Dramaturgin Sigrid Neef: »In Wort wie aufführungspraktischer Tat wurde Rimski-Korsakow zum Schilderer altrussischer Sitten und heidnischen Brauchtums gemacht. Unter prächtigen Kostümen, unter Kaftan und Sarafan erstickten die Figuren, und an die Stelle von lebendigen Gestalten traten folkloristisch aufgeputzte Opernsänger.«
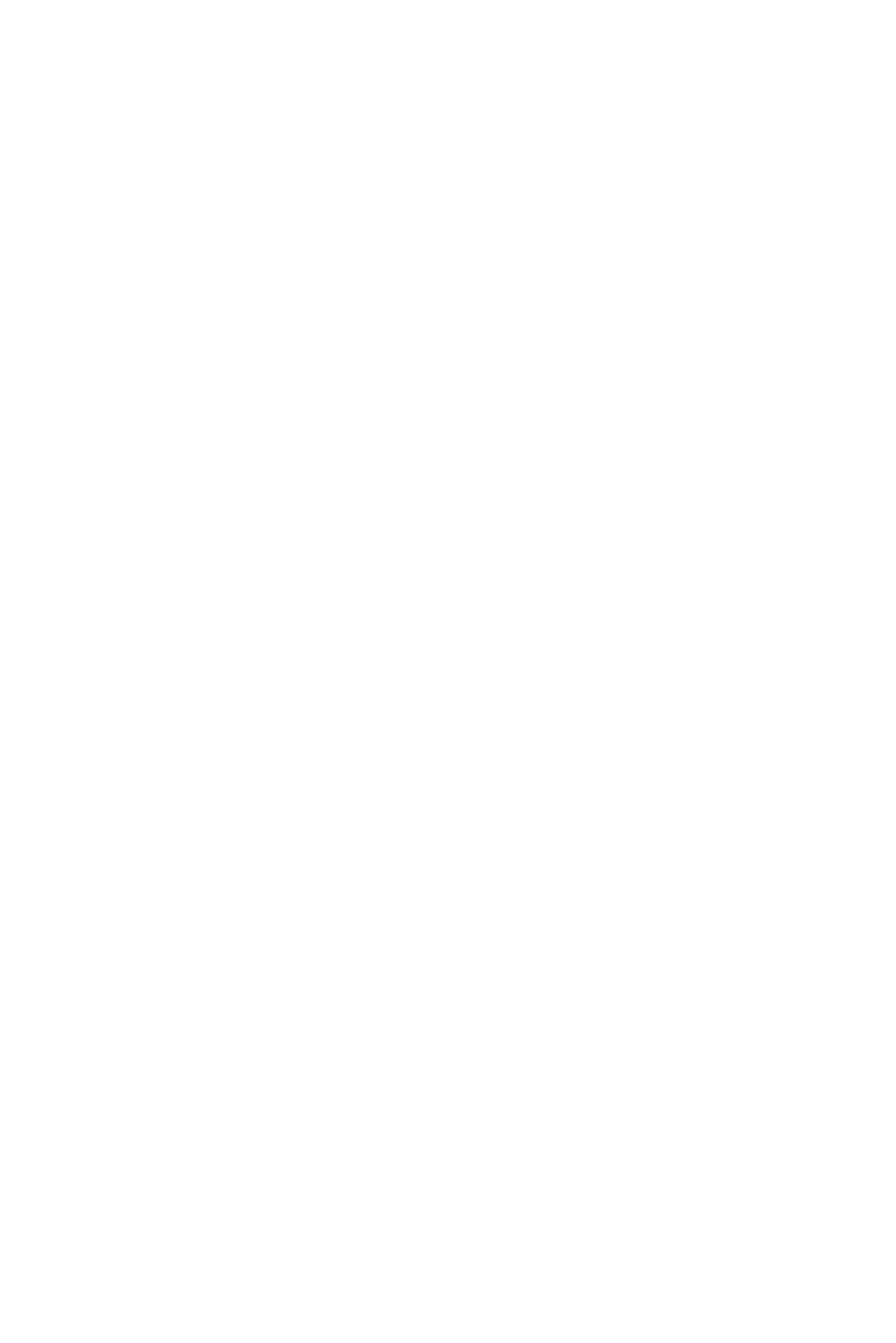
© Monika Rittershaus
Die »altrussischen Sitten« in Der goldene Hahn sind das abschreckende Gebaren eines autoritären Herrschers. Inwieweit das reale Verhalten des Zaren Nikolaus II. zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts die Komposition der Oper beeinflusste, bleibt spekulativ. Die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Russland und Japan um einen Pazifikhafen auf ursprünglich chinesischem Territorium betrafen 1904 auch Rimski-Korsakows Familie, als ein Mitglied bei einem Minenunfall eines Kriegsschiffs ums Leben kam. Einige Monate nach diesem Ereignis schickte Belski dem Komponisten Alfred Kubins um 1902 entstandene Tuschezeichnung Das Grausen und hoffte, dass es ihn zu einer symphonischen Dichtung inspirieren würde. Das Bild zeigt ein sich im Sturm aufbäumendes Schiff, vor dem aus der tosenden See ein grinsender Totenkopf mit einem übermäßigen Augapfel ragt. Belskis Hoffnung auf eine symphonische Dichtung wurde zwar nicht erfüllt, doch die groteske, unheimliche Bildwelt des österreichischen Künstlers könnte Spuren in Der goldene Hahn hinterlassen haben.
Die militärischen Auseinandersetzungen vergrößerten die ohnehin aufgeladene Atmosphäre der gedemütigten Bevölkerung, die sich auch am Petersburger Konservatorium entlud. Rimski-Korsakow solidarisierte sich mit den protestierenden Studierenden und wurde seines Amtes enthoben. Bis Ende des Jahres wurde er zwar wieder eingesetzt, doch in den letzten Zeilen seiner im August 1906 vollendeten Chronik lassen sich Auswirkungen der Ereignisse erkennen: »Seit der Vollendung der Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch [1904] verfolgte mich der Gedanke, ob es nicht an der Zeit sei, meine kompositorische Tätigkeit zu beenden. Auch jetzt legte ich mir diese Frage wieder vor. Die Nachrichten aus Russland bestärkten mich in meiner inneren Unruhe«. Seine Komponistenkollegen Alexander Glasunow und Anatoli Ljadow motivierten ihn zwar erneut, und er entschloss sich, das Konservatorium nicht zu verlassen, solange ihn die Umstände nicht dazu zwängen. »Ob ich weiter komponieren werde, weiß ich nicht. Jedenfalls mag ich nicht in die traurige Lage eines Sängers geraten, der seine Stimme verloren hat. Kommt Zeit, kommt Rat …«
Er verlor seine Stimme nicht, sondern verlieh den Figuren seiner letzten Oper charakterisierende Stimmen, die gleichzeitig deren Rätselhaftigkeit im Sinne des Märchens erhalten: polternd und pompös Dodon, betörend und beseelt die Königin, geheimnisvoll der Astrologe, alarmierend der Hahn, mütterlich und bedrohlich Amelfa, berechnend die beiden Söhne, pflichtbewusst der Heerführer Polkan. Diese bei Puschkin nicht vorkommende Figur erhielt einen Namen, den in Russland gern Wachhunde bekamen. Den Astrologen, der nur im Märchen konkret als Eunuch benannt wird, komponiert Rimski-Korsakow für eine extrem hohe Tenorlage und bezieht sich dabei auf die Tradition, alte Männer mit diesem Stimmfach zu charakterisieren. Seinen Worten verleiht der Astrologe mit abgesetzten Einzeltönen für jede Silbe besondere Aufmerksamkeit. Begleitet unter anderem von Piccolo- flöte, Glockenspiel, Harfe und gezupften Geigen wirken sie wie aus einer von Dodon weit entfernten Welt. Der sphärische Klang, getragen von Harfe, Celesta und hohen Streichern, ist auch der Königin zu eigen, doch zusammen mit ihrem Gesang wird er zu einem schier unendlichen soghaften Rausch.
Wo der Astrologe schelmisch durch seine hohen Töne hüpft, schwimmt sie auf einem klingenden Strom, in den sie den hingerissenen Dodon betörend hineinzieht. Im Gegensatz zum erzählerischen, realistisch anmutenden Ton aller anderen Figuren auf der Bühne – die Stimme des Hahns soll nur von »hinter der Szene« zu hören sein – scheint die Klangwelt von Astrologe und Königin aus einer anderen Sphäre zu kommen. Umso erstaunlicher wirkt die Aussage des Astrologen am Ende des Stücks, dass in diesem Märchen nur sie beide echte Menschen waren, alle anderen Traumgestalten. Die Verwunde- rung darüber ist aber wohl nur von kurzer Dauer, scheinen doch zu diesem Zeitpunkt Begriffe wie Realität und Echtheit selbst in Frage gestellt.
Die militärischen Auseinandersetzungen vergrößerten die ohnehin aufgeladene Atmosphäre der gedemütigten Bevölkerung, die sich auch am Petersburger Konservatorium entlud. Rimski-Korsakow solidarisierte sich mit den protestierenden Studierenden und wurde seines Amtes enthoben. Bis Ende des Jahres wurde er zwar wieder eingesetzt, doch in den letzten Zeilen seiner im August 1906 vollendeten Chronik lassen sich Auswirkungen der Ereignisse erkennen: »Seit der Vollendung der Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch [1904] verfolgte mich der Gedanke, ob es nicht an der Zeit sei, meine kompositorische Tätigkeit zu beenden. Auch jetzt legte ich mir diese Frage wieder vor. Die Nachrichten aus Russland bestärkten mich in meiner inneren Unruhe«. Seine Komponistenkollegen Alexander Glasunow und Anatoli Ljadow motivierten ihn zwar erneut, und er entschloss sich, das Konservatorium nicht zu verlassen, solange ihn die Umstände nicht dazu zwängen. »Ob ich weiter komponieren werde, weiß ich nicht. Jedenfalls mag ich nicht in die traurige Lage eines Sängers geraten, der seine Stimme verloren hat. Kommt Zeit, kommt Rat …«
Er verlor seine Stimme nicht, sondern verlieh den Figuren seiner letzten Oper charakterisierende Stimmen, die gleichzeitig deren Rätselhaftigkeit im Sinne des Märchens erhalten: polternd und pompös Dodon, betörend und beseelt die Königin, geheimnisvoll der Astrologe, alarmierend der Hahn, mütterlich und bedrohlich Amelfa, berechnend die beiden Söhne, pflichtbewusst der Heerführer Polkan. Diese bei Puschkin nicht vorkommende Figur erhielt einen Namen, den in Russland gern Wachhunde bekamen. Den Astrologen, der nur im Märchen konkret als Eunuch benannt wird, komponiert Rimski-Korsakow für eine extrem hohe Tenorlage und bezieht sich dabei auf die Tradition, alte Männer mit diesem Stimmfach zu charakterisieren. Seinen Worten verleiht der Astrologe mit abgesetzten Einzeltönen für jede Silbe besondere Aufmerksamkeit. Begleitet unter anderem von Piccolo- flöte, Glockenspiel, Harfe und gezupften Geigen wirken sie wie aus einer von Dodon weit entfernten Welt. Der sphärische Klang, getragen von Harfe, Celesta und hohen Streichern, ist auch der Königin zu eigen, doch zusammen mit ihrem Gesang wird er zu einem schier unendlichen soghaften Rausch.
Wo der Astrologe schelmisch durch seine hohen Töne hüpft, schwimmt sie auf einem klingenden Strom, in den sie den hingerissenen Dodon betörend hineinzieht. Im Gegensatz zum erzählerischen, realistisch anmutenden Ton aller anderen Figuren auf der Bühne – die Stimme des Hahns soll nur von »hinter der Szene« zu hören sein – scheint die Klangwelt von Astrologe und Königin aus einer anderen Sphäre zu kommen. Umso erstaunlicher wirkt die Aussage des Astrologen am Ende des Stücks, dass in diesem Märchen nur sie beide echte Menschen waren, alle anderen Traumgestalten. Die Verwunde- rung darüber ist aber wohl nur von kurzer Dauer, scheinen doch zu diesem Zeitpunkt Begriffe wie Realität und Echtheit selbst in Frage gestellt.
Von der Realität Dodons maximal entfernt ist die Königin nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch ihre Herkunft. In Washington Irvings 1831 erschienener Sage vom arabischen Astrologen, auf die sich Puschkin einige Jahre später mit seinem Märchen bezieht, ist diese Figur ein »christliches Fräulein« und damit für den maurischen König eine Sehnsuchtsgestalt aus einer anderen Kultur. Der amerikanische Schriftsteller Irving befand sich seit 1829 als diplomatischer Gesandter in Andalusien, was die Verortung seiner Geschichte erklären könnte. Sein Text wurde in Puschkins Nachlass gefunden. Der russische Autor veränderte ihn jedoch stark und adaptierte ihn für seinen Kulturraum. Als Sehnsuchtsgestalt des Zaren Dodon stammt die Frau nun aus Schemacha, wohl nur dem Namen nach an einen Ort im heutigen Aserbaidschan erinnernd. Ähnlich wie der arabische Raum in der zentraleuropäischen Literatur und Musik des 18. Jahrhunderts – Wolfgang Amadeus Mozarts Die Entführung aus dem Serail als bekanntes Beispiel – galt aus zentralrussischer Perspektive der (süd-)östliche Teil des Landes als geheimnisvoll faszinierender Ort des Fremden, wo den Frauen ein ungehemmtes Liebesbedürfnis angedichtet wurde. Als vom Zarismus unterjochtes Gebiet lernte auch Rimski-Korsakow 1893 einen Teil dieser Region kennen und berichtet in seiner Chronik von dieser Faszination: »Trotz der Kürze unseres Besuches gewannen wir die Südküste der Krim sofort lieb.
Bachtschissarai mit seinen unendlich langen Straßen, seinen Basaren, Kaffeestuben und schreienden Händlern, den Gebetsrufen der Muezzins von den Minaretten der Moscheen und seiner orientalischen Musik machte wahrlich einen eigenartigen Eindruck. Hier in Bachtschissarai hörte ich […] zum ersten Mal orientalische Musik ‚in natura‘ und ich glaube, dass ich ihre wesentlichsten Merkmale sogleich erfasst habe. Ganz erstaunlich, was sich mit den scheinbar zufälligen, an keinen Takt gebundenen Trommelschlägen für Wirkungen erzielen lassen. Damals waren die Straßen von Bachtschissarai noch von frühmorgens bis tief in die Nacht voll Musik, überall wurde getanzt und gesungen – der Orientale liebt die Musik.«
Mit Elementen dieser Musik, die er auf seinen Reisen kennengelernt hatte, wie reichhaltiger Chromatik, übermäßigen Intervallen, unaufgelösten Spannungen durch Leittöne oder dem Changieren zwischen Dur und Moll, stattete der Komponist die Klangwelt der Königin von Schemacha aus.
Einer Idealisierung dieser Figur, wie sie Rimski-Korsakow wohl zeitweise vorschwebte, wirkte Belski entgegen. Er sah in ihr »eine teuflische Verfüh- rung durch das Gefühl der Schönheit, und ihre Behandlung als ein Ideal der reinen Schönheit würde im Sujet all das vernichten, was mit dem Gedanken eines Gegensatzes zwischen dem Sittlichen und dem auf der Szene herrschen- den unendlichen Bösen verbunden ist«, wie er 1907 an den Komponisten schrieb. Ihre Abgründigkeit enthüllt die Königin in ihrer schelmischen Freude, in der sie den König verschämt ein Lied anstimmen und einen unbeholfenen Tanz vorführen lässt. Singen und Tanzen, die beiden ausgelassenen, für Andere unkontrollierbaren Ausdrucksweisen ungebändigter Sinnlichkeit, die Rimski-Korsakow auf der Krim so bewundert hat, werden zu ihrer Waffe gegen den respektlosen Aneignungsversuch Dodons. Sie stehen exemplarisch für seine persönlichen Ängste, von denen ihn sein Machtgebaren nicht befreien kann. Zu diesen Ängsten gehört auch das Lachen, weshalb die letzte Äußerung der Königin in ihrer Treffsicherheit besticht: Nachdem Dodon vom Hahn getötet wurde, ist nur noch ihr Lachen zu hören, bevor sie von der Szene verschwindet. »Ich hoffe, dass mir eine vollständige Entlarvung des Dodon gelungen ist«, schreibt der Komponist 1907.
Zurück bleibt ein ratloses Volk, das aus vorsichtigem Stammeln einen Trauergesang über den verlorenen Herrscher anstimmt. Ein neues Morgenrot ohne König erscheint unvorstellbar, weil die Menschen in ihrer willfährigen Konzentration auf seine Macht sich ihrer eigenen Verantwortlichkeit nicht bewusst sind. Brutal und respektlos hat der Herrscher seine Macht darauf gegründet und dabei nicht nur die Menschlichkeit seiner Untergebenen missachtet, sondern auch seine eigene. Entlarvend verschafft Rimski-Korsakow dieser in Gestalt von Dodons Abgründen, Sehnsüchten und Ängsten ihren Raum. Der angeblich nicht an das Übernatürliche glaubende Komponist bekannte 1895: »Meine Opern sind in ihrem Wesen tiefreligiös, weil ich mich darin überall ehrfürchtig vor der Natur verneige beziehungsweise gerade diese Respektbezeigung thematisiere.«
Bachtschissarai mit seinen unendlich langen Straßen, seinen Basaren, Kaffeestuben und schreienden Händlern, den Gebetsrufen der Muezzins von den Minaretten der Moscheen und seiner orientalischen Musik machte wahrlich einen eigenartigen Eindruck. Hier in Bachtschissarai hörte ich […] zum ersten Mal orientalische Musik ‚in natura‘ und ich glaube, dass ich ihre wesentlichsten Merkmale sogleich erfasst habe. Ganz erstaunlich, was sich mit den scheinbar zufälligen, an keinen Takt gebundenen Trommelschlägen für Wirkungen erzielen lassen. Damals waren die Straßen von Bachtschissarai noch von frühmorgens bis tief in die Nacht voll Musik, überall wurde getanzt und gesungen – der Orientale liebt die Musik.«
Mit Elementen dieser Musik, die er auf seinen Reisen kennengelernt hatte, wie reichhaltiger Chromatik, übermäßigen Intervallen, unaufgelösten Spannungen durch Leittöne oder dem Changieren zwischen Dur und Moll, stattete der Komponist die Klangwelt der Königin von Schemacha aus.
Einer Idealisierung dieser Figur, wie sie Rimski-Korsakow wohl zeitweise vorschwebte, wirkte Belski entgegen. Er sah in ihr »eine teuflische Verfüh- rung durch das Gefühl der Schönheit, und ihre Behandlung als ein Ideal der reinen Schönheit würde im Sujet all das vernichten, was mit dem Gedanken eines Gegensatzes zwischen dem Sittlichen und dem auf der Szene herrschen- den unendlichen Bösen verbunden ist«, wie er 1907 an den Komponisten schrieb. Ihre Abgründigkeit enthüllt die Königin in ihrer schelmischen Freude, in der sie den König verschämt ein Lied anstimmen und einen unbeholfenen Tanz vorführen lässt. Singen und Tanzen, die beiden ausgelassenen, für Andere unkontrollierbaren Ausdrucksweisen ungebändigter Sinnlichkeit, die Rimski-Korsakow auf der Krim so bewundert hat, werden zu ihrer Waffe gegen den respektlosen Aneignungsversuch Dodons. Sie stehen exemplarisch für seine persönlichen Ängste, von denen ihn sein Machtgebaren nicht befreien kann. Zu diesen Ängsten gehört auch das Lachen, weshalb die letzte Äußerung der Königin in ihrer Treffsicherheit besticht: Nachdem Dodon vom Hahn getötet wurde, ist nur noch ihr Lachen zu hören, bevor sie von der Szene verschwindet. »Ich hoffe, dass mir eine vollständige Entlarvung des Dodon gelungen ist«, schreibt der Komponist 1907.
Zurück bleibt ein ratloses Volk, das aus vorsichtigem Stammeln einen Trauergesang über den verlorenen Herrscher anstimmt. Ein neues Morgenrot ohne König erscheint unvorstellbar, weil die Menschen in ihrer willfährigen Konzentration auf seine Macht sich ihrer eigenen Verantwortlichkeit nicht bewusst sind. Brutal und respektlos hat der Herrscher seine Macht darauf gegründet und dabei nicht nur die Menschlichkeit seiner Untergebenen missachtet, sondern auch seine eigene. Entlarvend verschafft Rimski-Korsakow dieser in Gestalt von Dodons Abgründen, Sehnsüchten und Ängsten ihren Raum. Der angeblich nicht an das Übernatürliche glaubende Komponist bekannte 1895: »Meine Opern sind in ihrem Wesen tiefreligiös, weil ich mich darin überall ehrfürchtig vor der Natur verneige beziehungsweise gerade diese Respektbezeigung thematisiere.«
Mehr dazu
30. Januar 2024
Stimmlich und darstellerisch grandios verkörpert Dmitry Ulyanov den König und verdeutlicht, warum es bei Kosky nicht leicht ist, ein Despot zu sein. ...
Sopranistin Kseniia Proshina wird gewissermaßen der rote Teppich ausgerollt. Was sie gar nicht nötig hat. Die Sängerin kann mit einer Eleganz verführen, ihr lyrischer Sopran bewegt sich voller Leichtigkeit durch die Partie, auch wenn sie die geforderten Spitzentöne nur anreißt.
Sopranistin Kseniia Proshina wird gewissermaßen der rote Teppich ausgerollt. Was sie gar nicht nötig hat. Die Sängerin kann mit einer Eleganz verführen, ihr lyrischer Sopran bewegt sich voller Leichtigkeit durch die Partie, auch wenn sie die geforderten Spitzentöne nur anreißt.
Fantasien eines einsamen Königs, Volker Blech, Berliner Morgenpost
#KOBGoldenerHahn
30. Januar 2024
Barry Koskys stupend präzise Inszenierung des „Goldenen Hahns“ hat schon eine kleine Reise hinter sich von Aix-en Provence über Lyon und Adelaide nach Berlin , an die Komische Oper, also ans Schillertheater, das derzeitige Quartier der Truppe. ... Der Dirigent James Gaffigan wirkt, als habe er sich vollkommen in diese Musik verknallt, er umsorgt jedes kleinste Detail, er schildert plastisch, aufregend, elegant. Proshina und Ulyanov müssten gar nichts singen, die Musik erzählte alles, bohrende Neugierde am anderen, von ihr ironisch, spielerisch, verführerisch dargeboten.
Irre werden an der Schönheit, Egbert Tholl, Süddeutsche Zeitung
#KOBGoldenerHahn
29. Januar 2024
Barrie Kosky nimmt uns mit in eine düster-romantische Bühnenwelt. Ein Szenario wie von Caspar David Friedrich gemalt. ... Dmitry Ulyanov verkörpert diesen König Dodon in feinster Falstaffmanier als bramarbasierend-donnernder Bass. Die matarihafte Verführerin singt Kseniia Proshina mit schillernd-umgarnendem Sopran, eiskalte Spitzen setzend, in orientalisch-verschlungenen Läufen in der überhaupt klangfarbenreichen Musik Rimsky-Korsakows. ... Die entfaltet das Orchester der Komischen Oper unter der Leitung des neuen Generalmusikdirektors James Gaffigan einfühlsam: von zart-romantisch bis zur überdrehten Farce.
Dystopisches Märchen: »Der Goldene Hahn« an der Komischen Oper, Barbara Wiegand, rbb Inforadio
#KOBGoldenerHahn
29. Januar 2024
Das war ein runder, voller Erfolg! Die Komische Oper hat gepunktet. Und zwar mit einem Werk, das ja wirklich ans Haus passt. ... Es ist keine platte Aktualisierung, es ist für Kosky ein Märchen und es geht um die Magie der Bilder. Und alles, was man für heute daraus ableiten könnte, überlässt Kosky der Intelligenz des Publikums. ... James Gaffigan hat diese vielschichtige Partitur wirklich ausgeleuchtet bis in die hintersten Winkel. ... Ein kurzweiliges Vergnügen, der Chor - das Rückgrat des Hauses - mal wieder grandios. ... Wer da hingeht, macht nichts falsch!
Premiere an der Komischen Oper »Der goldene Hahn«, Andreas Göbel, rbbKultur
#KOBGoldenerHahn
26. Januar 2024
Kein einziger schwacher Moment
Der goldene Hahn ist Nikolai Rimski-Korsakows ausgefeilteste und musikalisch farbenprächtigste Oper. Seine meisterhafte Partitur lässt die Geschichte und ihre Figuren sinnlich erleben und schafft es, Erotik nicht nur verführerisch, sondern auch tiefgründig und authentisch klingen zu lassen. Im Gespräch erzählen Dirigent James Gaffigan und Regisseur Barrie Kosky über ein Kind, das einen König spielt, über die Inszenierung eines Deliriums und eine Oper im Gewand einer schwarzen Komödie.
#KOBGoldenerHahn
Interview
