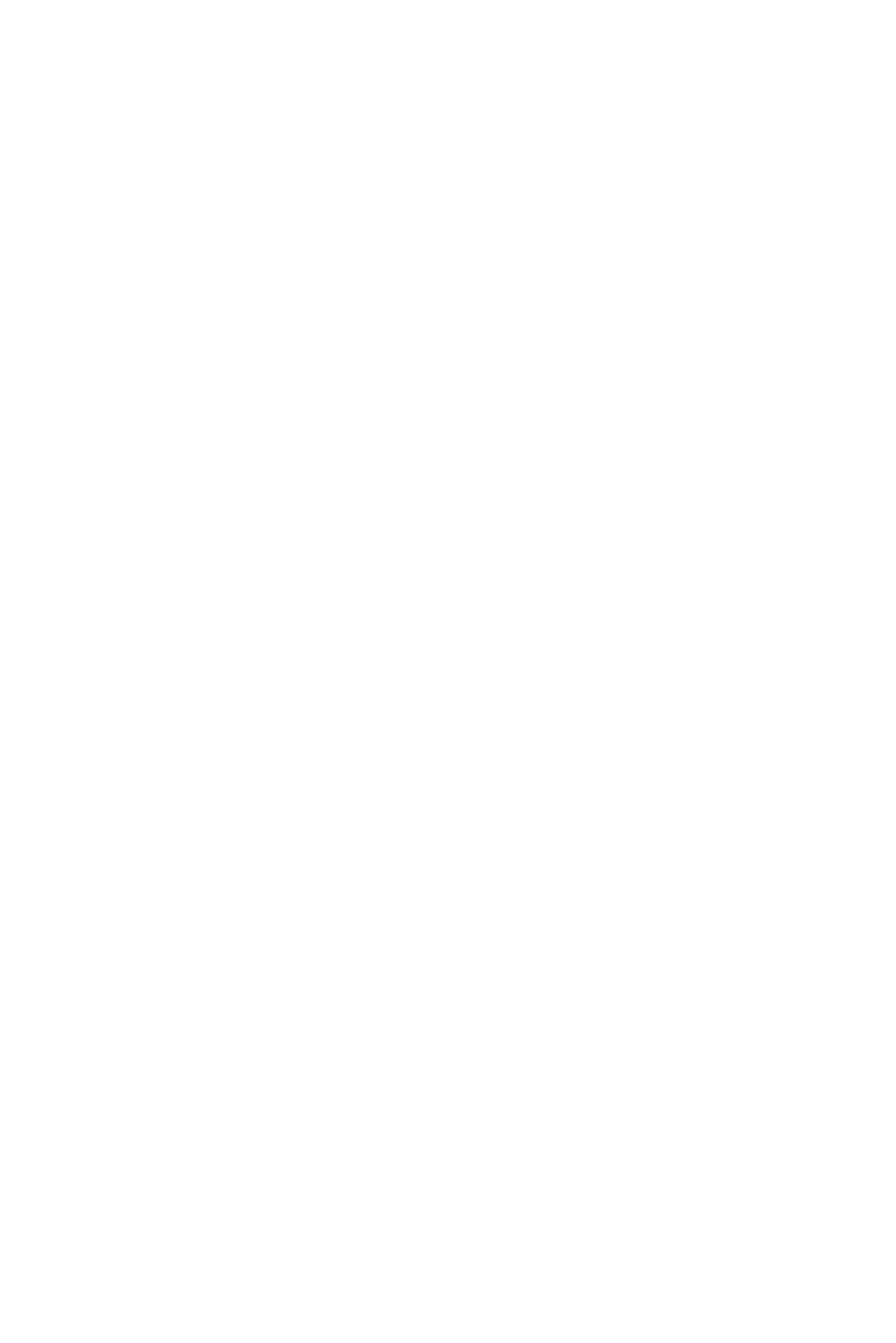© Monika Rittershaus
Der lange Weg des Andersartigen
Zu Ambroise Thomas’ Oper, Shakespeares Tragödie und ihrer Verbindung – von Julia Jordà Stoppelhaar
Ambroise Thomas kam 1811 als musikalisches Wunderkind zur Welt. Im Alter von neun Jahren spielte er bereits auf professionellem Niveau Klavier und Geige. Ein mit Musikpreisen gespickter Weg ebnete sich hin zu einer exemplarischen akademischen Laufbahn – der nächste logische Schritt für den Sohn einer hochmusikalischen Familie mit einem Violinisten-Vater und einer klavierbegabten Mutter aus Metz (Frankreich).
Was sich zunächst wie eine Biografie des Überfliegers Mozarts liest, mündet allerdings nicht in begeistertem Echo für Thomas’ Opern, die bis auf wenige Ausnahmen Anfang des 20. Jahrhunderts in Vergessenheit gerieten. Zu akademisch, zu französisch und vor allem: zu konservativ. Thomas wurde einiges angelastet, dabei zeichnet er für die einzige bis heute gespielte Hamlet-Vertonung verantwortlich. Warum eigentlich?
Was sich zunächst wie eine Biografie des Überfliegers Mozarts liest, mündet allerdings nicht in begeistertem Echo für Thomas’ Opern, die bis auf wenige Ausnahmen Anfang des 20. Jahrhunderts in Vergessenheit gerieten. Zu akademisch, zu französisch und vor allem: zu konservativ. Thomas wurde einiges angelastet, dabei zeichnet er für die einzige bis heute gespielte Hamlet-Vertonung verantwortlich. Warum eigentlich?
Der Startpunkt: Zwischen Altem und Neuem
Auch wenn Ambroise Thomas das neue Genre des Drame lyrique mitprägte, begann seine Karriere als Opernkomponist mit der bereits im 17. Jahrhundert entstandenen Opéra comique. Vornehmlich wurden diese Opern am Haus der Pariser Opéra Comique gezeigt, das aus einer bürgerlichen Tradition entstanden war und den Konkurrenzkampf mit der dem französischen Hof vorbehaltenen Pariser Opéra ausgefochten hatte. An der Comique kam es für Thomas zu ersten Erfolgen, beispielsweise mit Le Caïd (1849) und Le Songe d’une nuit d’été (1850), deren Strahlkraft ihm eine Reihe bedeutsamer Ehren einbrachte: Er wurde zum Mitglied der Académie des Beaux-Arts ernannt, dann zum Professor für Komposition am Pariser Konservatorium und letztlich 1871 zum Direktor desselben. Er komponierte für die im Zweiten Kaiserreich beliebten Massenchöre und war dort gleichzeitig Jury-Mitglied. Kurz gefasst: Thomas hatte seinen Platz im Pariser Establishment gefunden und auf Lebzeit gesichert. Das wirkte sich auch auf die Wahrnehmung seiner Kunst aus. Thomas’ Leben umspannte fast ein ganzes Jahrhundert von 1811 bis 1896, und für den ehrgeizigen Komponisten war wohl diese Epoche zwischen Tradition und Aufbruch, Zweitem Kaiserreich und Dritter Republik ein künstlerischer Ritt auf der Rasierklinge – auf der einen Seite die prestigeträchtige französische Operntradition und auf der anderen Seite die aufkommende Moderne.
Der Schritt zurück oder Anlauf nehmen
Sechzehn Werke komponierte Thomas ganz dem Genre getreu für die Bühne der Opéra Comique. Opern mit klarer Struktur, kleiner Besetzung und melodienreicher Musik – auch wenn er dies mit den letzten Werken, wie das 1858 komponierte Gille et Gillotin, in einer Zeit tat, in der die Gattung nach und nach mit ihrem Gegenstück, der Grand Opéra, verschmolz und somit in ihrer ursprünglichen Form überholt war.
Vielleicht spürte Thomas selbst, dass die Opéra comique ein epigonenhaftes Dasein fristete, zumal Gille et Gillotin mit juristischen Mitteln und ohne Probenbetreuung durch ihren Komponisten nachträglich auf die Bühne gewuchtet wurde. Vielleicht warf auch seine Karriere einen zu großen Schatten auf seinen musikalischen Einfallsreichtum. In jedem Fall folgten ab 1860 sechs Jahre Stille.
Vielleicht spürte Thomas selbst, dass die Opéra comique ein epigonenhaftes Dasein fristete, zumal Gille et Gillotin mit juristischen Mitteln und ohne Probenbetreuung durch ihren Komponisten nachträglich auf die Bühne gewuchtet wurde. Vielleicht warf auch seine Karriere einen zu großen Schatten auf seinen musikalischen Einfallsreichtum. In jedem Fall folgten ab 1860 sechs Jahre Stille.
Der Sprung ins Rampenlicht: Die erste Grand Opéra
In dieser Zeit entstanden Charles Gounods zukunftsweisende Goethe-Adaption Faust (1859) und seine Shakespeare-Oper Roméo et Juliette (1867). Nun waren Werke auf Basis von literarischen Vorlagen, zumal der auch damals unbestritten besten Schriftsteller, im Frankreich des 19. Jahrhunderts nichts Seltenes. Logisch also, dass Thomas sich 1866 mit Mignon (einer Goethe-Bearbeitung) aus der Sendepause zurückmeldete und sich in der Pariser Musikwelt dank Mignons musikdramaturgischer Durchdringung endgültig als ernstzunehmender französischer Opernkomponist etablierte. Gounod und Thomas teilten aber vor allem ihre Librettisten, die Stars der damaligen Opernszene schlechthin: Jules Barbier und Michel Carré.
Mit ihnen in enger Zusammenarbeit feilte Thomas schon während seiner Schaffenspause seit 1860 an Hamlet – in der Hoffnung, diesmal an der Pariser Opéra zu landen. Zwar hatte er hier schon zuvor Premieren gefeiert, zum Beispiel mit dem Zweiakter Le Comte de Carmagnola (1841), doch nun kehrte er im Erfolgsrausch Mignons mit seiner ersten Grand Opéra zurück. Die strengen Subventionsbedingungen der Opéra verlangten nämlich nach einer jährlichen Grand Opéra, um den Status der Institution zu erhalten. Fünf Akte musste sie haben, Ballettmusik und einen dramatischen, historischen Stoff. Zu dem Zweck bearbeitete Thomas seinen Hamlet entsprechend: Er teilte den vierten Akt in zwei, schrieb zusätzliche Ballettmusik im neuen vierten Akt und machte Anpassungen in der Besetzung. Am 9. März 1868 feierte seine erste große Oper endlich ihre Uraufführung.
Mit ihnen in enger Zusammenarbeit feilte Thomas schon während seiner Schaffenspause seit 1860 an Hamlet – in der Hoffnung, diesmal an der Pariser Opéra zu landen. Zwar hatte er hier schon zuvor Premieren gefeiert, zum Beispiel mit dem Zweiakter Le Comte de Carmagnola (1841), doch nun kehrte er im Erfolgsrausch Mignons mit seiner ersten Grand Opéra zurück. Die strengen Subventionsbedingungen der Opéra verlangten nämlich nach einer jährlichen Grand Opéra, um den Status der Institution zu erhalten. Fünf Akte musste sie haben, Ballettmusik und einen dramatischen, historischen Stoff. Zu dem Zweck bearbeitete Thomas seinen Hamlet entsprechend: Er teilte den vierten Akt in zwei, schrieb zusätzliche Ballettmusik im neuen vierten Akt und machte Anpassungen in der Besetzung. Am 9. März 1868 feierte seine erste große Oper endlich ihre Uraufführung.
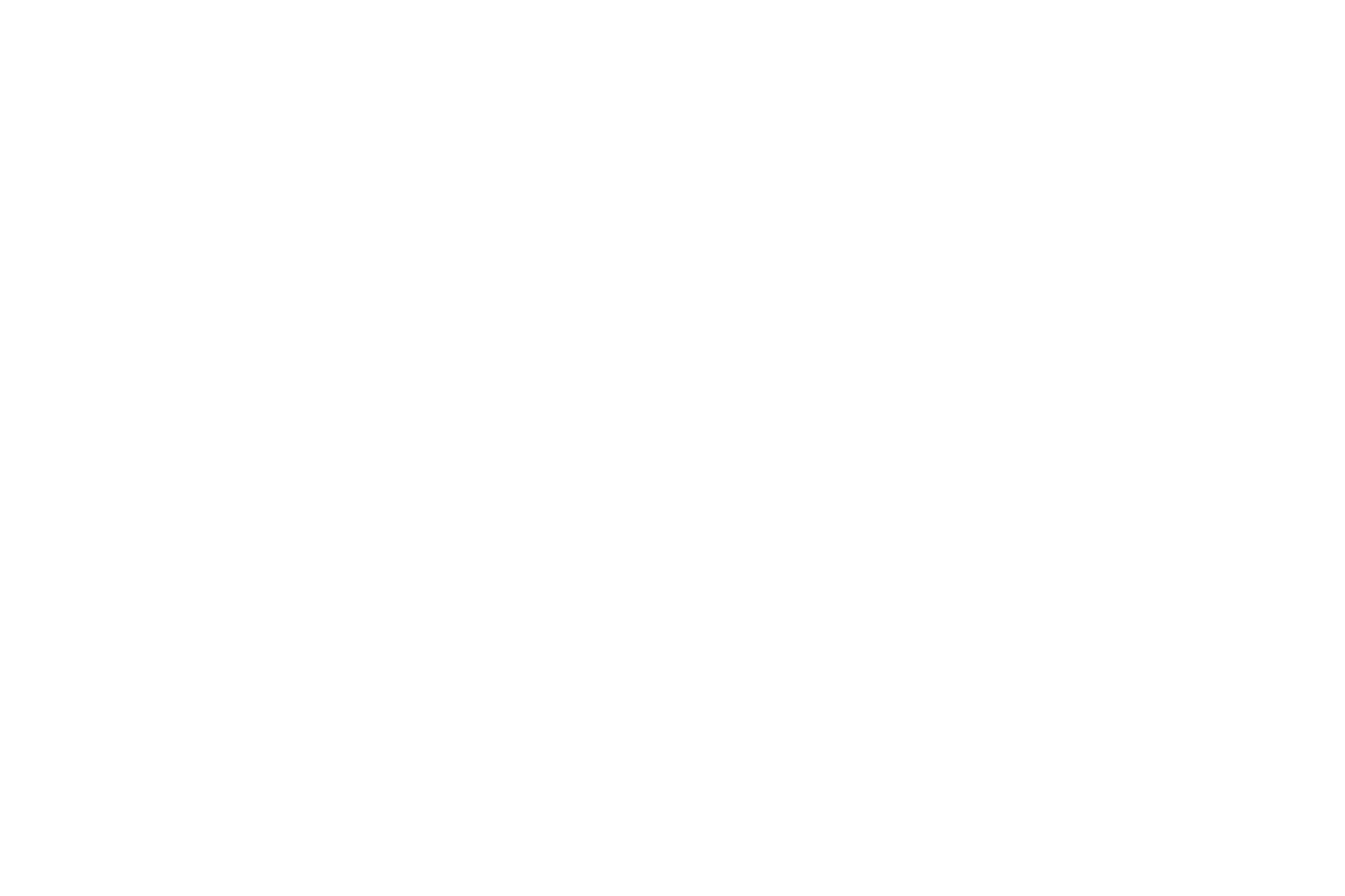
© Monika Rittershaus
Ein Schritt weiter: das Drame lyrique
Gestützt auf die Traditionen der Grand Opéra hob Thomas mit Hamlet in die Welt des Drame lyrique ab und bereitete damit das Opernverständnis Jules Massenets und Georges Bizets vor. Thomas prägte den Stil des Drame lyrique zwischen der Ausgelassenheit der Opéra comique und dem Pathos der Grand Opéra mit. Dabei konzentrierte sich die Handlung auf wenige Figuren und bot somit intimeren Szenen Platz. Trinklieder, Balladen und Volksliedgut wurden mit deklamatorischem Gesangs-Stil und Melodienreichtum im Orchester verbunden. Die Figuren rückten näher an das Leben heran, waren keine Held:innen oder überzeichnete Typen mehr, sondern wurden innerhalb ihres sozialen Umfelds gezeigt. Mehr noch: Das gesellschaftliche Netz, in das die Charaktere verflochten sind, bestimmt ihr Handeln und stellt die Gesetze dafür auf. Analog hierzu entwickelte Thomas musikdramaturgisch ein raffiniertes Machtspiel zwischen Königin Gertrude, Hamlet und Ophélie. Im Sinne des Drame lyrique stellte Ambroise Thomas Hamlet mit Ophélie eine ebenbürtige Frauenfigur zur Seite. Hamlets lang vergangenen Liebesschwur im Duett »Doute de la lumière« noch im Ohr – und als aufstrebendes romantisches Motiv im Vorspiel – stimmt sie im zweiten Akt ihre Arie an. Als Hamlet mittendrin auftritt, sie aber ignoriert, hat sie den Beweis für seine doch erkaltete Liebe. Bei Königin Gertrude bittet sie darum, den Hof verlassen zu dürfen.
Regisseurin Nadja Loschky packt die Gelegenheit beim Schopf, Ophélie als Frauenfigur nicht dem fragilen Rollenklischée zum Opfer fallen zu lassen, sondern zeigt sie als eigenwillige Person, der die Regeln des Hofes aber jegliche Eigenständigkeit verbieten. Gertrude gibt ihr keine Erlaubnis zu gehen, sondern nötigt sie vielmehr dazu, als ihre Spionin Hamlets »Wahnsinn« nachzugehen. Nach dem Wahnsinn gilt es in Thomas’ Oper jedoch an anderer Stelle zu suchen: Der ganz Ophélie gewidmete vierte Akt kulminiert in ihrer sogenannten Wahnsinnsszene. Nachdem sie behauptet, Hamlet sei ihr Ehemann, stimmt sie ein balladenhaftes Lied mit virtuos-erratischen Sopran-Koloraturen an, das im musikalischen Zitat des Themas aus »Doute de la lumière« mündet und Ophélies nahenden Tod einleitet. Bei Shakespeare ist die Tötung ihres Vaters Polonius durch Hamlet eine wichtige Motivation für Ophélies Selbstmord. Von den Librettisten Barbier und Carré wurde diese Szene aber gestrichen, um stattdessen einzig ihr gebrochenes Herz für ihren Verstandesverlust verantwortlich zu machen. Dass aber die starren Rollenvorstellungen des Hofes an eine junge Frau – und insbesondere Gertrudes Instrumentalisierung – sie in die Verzweiflung treiben, zeigt Nadja Loschky mit ihrer Inszenierung. Dabei arbeitet sie Ophélies Ähnlichkeit mit Hamlet heraus: Sie ist ebenso im Machtgefüge des Hofes gefangen, wie er machtlos ist in seinem Willen, sich aus der höfischen Gesellschaft zu lösen oder diese auszulöschen.
Regisseurin Nadja Loschky packt die Gelegenheit beim Schopf, Ophélie als Frauenfigur nicht dem fragilen Rollenklischée zum Opfer fallen zu lassen, sondern zeigt sie als eigenwillige Person, der die Regeln des Hofes aber jegliche Eigenständigkeit verbieten. Gertrude gibt ihr keine Erlaubnis zu gehen, sondern nötigt sie vielmehr dazu, als ihre Spionin Hamlets »Wahnsinn« nachzugehen. Nach dem Wahnsinn gilt es in Thomas’ Oper jedoch an anderer Stelle zu suchen: Der ganz Ophélie gewidmete vierte Akt kulminiert in ihrer sogenannten Wahnsinnsszene. Nachdem sie behauptet, Hamlet sei ihr Ehemann, stimmt sie ein balladenhaftes Lied mit virtuos-erratischen Sopran-Koloraturen an, das im musikalischen Zitat des Themas aus »Doute de la lumière« mündet und Ophélies nahenden Tod einleitet. Bei Shakespeare ist die Tötung ihres Vaters Polonius durch Hamlet eine wichtige Motivation für Ophélies Selbstmord. Von den Librettisten Barbier und Carré wurde diese Szene aber gestrichen, um stattdessen einzig ihr gebrochenes Herz für ihren Verstandesverlust verantwortlich zu machen. Dass aber die starren Rollenvorstellungen des Hofes an eine junge Frau – und insbesondere Gertrudes Instrumentalisierung – sie in die Verzweiflung treiben, zeigt Nadja Loschky mit ihrer Inszenierung. Dabei arbeitet sie Ophélies Ähnlichkeit mit Hamlet heraus: Sie ist ebenso im Machtgefüge des Hofes gefangen, wie er machtlos ist in seinem Willen, sich aus der höfischen Gesellschaft zu lösen oder diese auszulöschen.
Ausscheren: Wahnsinn oder Hellsicht
Seelenverwandt und doch entfremdet vereint Ophélie und Hamlet der echte oder nur vorgeworfene Wahnsinn. Bei der Frage nach Hamlets Verstand wird Thomas’ musikdramaturgische Begabung offensichtlich. Auch wenn die Librettisten – bis auf seinen berühmten Monolog »Sein oder Nichtsein« – die introspektiven Momente Hamlets aus Shakespeares Vorlage gestrichen haben, findet der Komponist einen Weg, mit der Wahrnehmung Hamlets zu spielen.
Frei von allen Operntraditionen komponiert Thomas im dritten Akt eine Dialogszene zwischen Gertrude und Hamlet, in der Hamlet seiner Mutter klar und deutlich seinen Hass auf sie als Mörderin seines Vaters entgegenschleudert. Mit insgesamt zwölf aufgewühlten Tempowechseln nimmt diese Szene Fahrt auf und zeigt einen klarsichtigen Hamlet, der von seiner Mutter als verrückt dargestellt wird. Dieser Eindruck Königin Gertrudes entsteht einerseits durch ihre Angst, entdeckt zu werden, andererseits durch Hamlets das Regelwerk sprengende Verhalten wie im zweiten Akt. Ganz im Stil des Drame lyrique stimmt Hamlet dort nämlich eine beschwingte und festliche »Chanson bachique«, also ein Trinklied an. Ambroise Thomas setzt das Trinklied aber gekonnt musikdramaturgisch ein, was diesen scheinbaren Feieranlass in eine düstere Szene kippen lässt. Als Hamlet mit Hilfe eines ausgeklügelten Schauspiels König Claudius als Mörder seines Vaters enttarnen will, setzt er an: »Wein, zerstreue die Sorgen.« (»Ô vin, dissipe la tristesse«). Nachdem die Mausefalle zugeschnappt ist und er Claudius laut als Verbrecher beschuldigt, bricht Tumult am Hof aus. Doch Thomas lässt Hamlet den sich empörenden Chor mit einer Reprise des Trinklieds unterbrechen. Ein bizarrer Einfall, wenn man die Tragweite der öffentlichen Anklage und der persönlichen Tragödie bedenkt. Während Gertrude und der Hof ihm Wahnsinn attestieren, nutzt Regisseurin Nadja Loschky diese Gelegenheit, um zu beweisen, dass Hamlet der einzige Hellsichtige ist, der Einzige, der aus dem vorgesehenen Weg ausschert und dadurch anders als alle anderen ist. Inspiriert von Shakespeares Satz »Etwas ist faul im Staate Dänemark« zeigt sie: Er ist der Einzige, der den Verfall hinter der höfischen Fassade sieht. Auch Etienne Pluss’ Bühnenbild, in dem ein repräsentativer Palastsaal mit herrschaftlicher Treppe nach und nach zerfällt, zeigt bildlich Hamlets Perspektive auf diese verrottete Welt.
Frei von allen Operntraditionen komponiert Thomas im dritten Akt eine Dialogszene zwischen Gertrude und Hamlet, in der Hamlet seiner Mutter klar und deutlich seinen Hass auf sie als Mörderin seines Vaters entgegenschleudert. Mit insgesamt zwölf aufgewühlten Tempowechseln nimmt diese Szene Fahrt auf und zeigt einen klarsichtigen Hamlet, der von seiner Mutter als verrückt dargestellt wird. Dieser Eindruck Königin Gertrudes entsteht einerseits durch ihre Angst, entdeckt zu werden, andererseits durch Hamlets das Regelwerk sprengende Verhalten wie im zweiten Akt. Ganz im Stil des Drame lyrique stimmt Hamlet dort nämlich eine beschwingte und festliche »Chanson bachique«, also ein Trinklied an. Ambroise Thomas setzt das Trinklied aber gekonnt musikdramaturgisch ein, was diesen scheinbaren Feieranlass in eine düstere Szene kippen lässt. Als Hamlet mit Hilfe eines ausgeklügelten Schauspiels König Claudius als Mörder seines Vaters enttarnen will, setzt er an: »Wein, zerstreue die Sorgen.« (»Ô vin, dissipe la tristesse«). Nachdem die Mausefalle zugeschnappt ist und er Claudius laut als Verbrecher beschuldigt, bricht Tumult am Hof aus. Doch Thomas lässt Hamlet den sich empörenden Chor mit einer Reprise des Trinklieds unterbrechen. Ein bizarrer Einfall, wenn man die Tragweite der öffentlichen Anklage und der persönlichen Tragödie bedenkt. Während Gertrude und der Hof ihm Wahnsinn attestieren, nutzt Regisseurin Nadja Loschky diese Gelegenheit, um zu beweisen, dass Hamlet der einzige Hellsichtige ist, der Einzige, der aus dem vorgesehenen Weg ausschert und dadurch anders als alle anderen ist. Inspiriert von Shakespeares Satz »Etwas ist faul im Staate Dänemark« zeigt sie: Er ist der Einzige, der den Verfall hinter der höfischen Fassade sieht. Auch Etienne Pluss’ Bühnenbild, in dem ein repräsentativer Palastsaal mit herrschaftlicher Treppe nach und nach zerfällt, zeigt bildlich Hamlets Perspektive auf diese verrottete Welt.
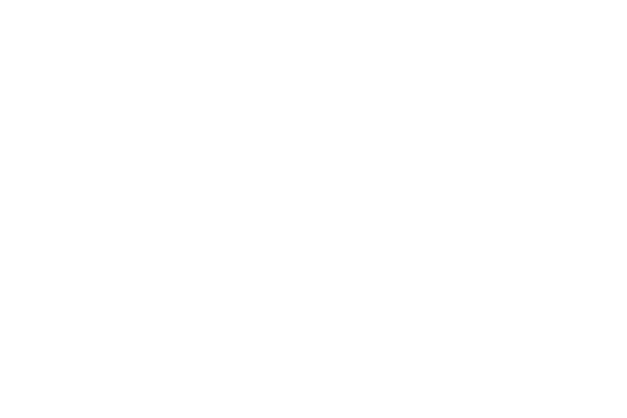
© Monika Rittershaus
Ehrenrunde der Instrumente: Ambroise Thomas' Orchestrierung
Trotz der Düsterheit der Schauspiel-Szene komponiert Thomas auch spielerische Momente, die wahre Innovation aufweisen. Besonders in der Bläsergruppe und in den tiefen Stimmen entwickelt er eine differenzierte und fantasievolle Instrumentation. Das Theater im Theater wird nämlich von einem Solo für Baritonsaxophon eingeführt. Zum ersten Mal in der Operngeschichte erklingt dieses von Adolphe Sax erfundene Instrument, den Ambroise Thomas am Pariser Konservatorium einstellte. Die leichte Melodie des Saxophons erinnert teils an eine menschliche Stimme und steht im starken Kontrast zur realen Situation des Mordkomplotts. Thomas verlegt den hauptsätzlichen Anteil der Melodieführung in Hamlet ins Orchester. Dabei weist er Hamlet vor allem das Violoncello zu und Ophélie Flöte und Harfe. Das Verhältnis von Stimme und Orchester wird bereits mit dem ersten Akt hörbar. Hier richtet sich der Geist – auf ein und demselben Ton – aus der Totenstarre an Hamlet. Die instrumentale Begleitung aber, eine neuartige Kombination von Englischhorn und Baritonsaxophon mit Streichern, birgt die eigentliche emotionale Tiefe dieser Szene. Thomas priorisiert das Verständnis des gesungenen Worts, mit ausgewählten hochvirtuosen Koloraturausbrüchen, und lässt das Orchester zum durchgängigen musikalischen Protagonisten werden, der die Szenen musikalisch und thematisch miteinander verbindet. Für seine originelle Orchestrierung und seine tiefgründige Musikdramaturgie wurde Ambroise Thomas mit Beifall belohnt. Hamlet schaffte es auf internationale Bühnen und wurde allein an der Pariser Opéra bis 1918 ganze 321 Mal gespielt. Nach acht Jahren Bearbeitungszeit am Ende ein einziger Erfolg. Oder?
Die Zielgerade: Ende gut, alles gut?
Barbier und Carré hatten im Sinne der französischen dramatischen Tradition ein Happy End für Hamlet gewählt. Bei der Pariser Uraufführung wurde Hamlet nach der Rache an Claudius zum König ausgerufen und starb nicht wie im Original durch Laërtes vergifteten Degen. Damit fußt das Libretto auf der französischen Adaption Hamlet von Alexandre Dumas dem Älteren und Paul Meurice.
Shakespeares Original war in frühen französischen Übersetzungen seiner realitätsnahen Sprache, vieler Charaktere und Handlungsstränge sowie auch der Figur des Geistes zugunsten eines angeblich erhabeneren Stils und einer leichter verdaulichen Handlung mit weniger Toden beraubt worden. Mit Beginn der romantischen Epoche öffnete sich die Tür einen Spalt weit für neue Übersetzungen und Dumas nutzte die Gelegenheit. Sein Schauspiel von 1847 ist in allen Punkten eine Rückbesinnung auf Shakespeares Tragödie. Einzig das französische Ende mit Hamlet auf dem Thron übernahm Dumas.
Für das Londoner Publikum war aber auch dieser Eingriff in das literarische Nationalerbe inakzeptabel. Das originale Ende musste her. Und so konzipierten Thomas, Barbier und Carré 1869 einen neuen Schluss mit sterbendem Hamlet. Auch hier wird das Duell mit Laërte unterbrochen, Hamlet rächt sich an Claudius, ganz ohne Geistererscheinung, und fällt letztlich leblos neben Ophélies Leiche zu Boden. Trotz dieser Fassung für englisches Publikum war die Akzeptanz nur mäßig, denn durch den beigefügten Tod atmete Shakespeares Geist gerade weniger in dieser Version.
Shakespeares Original war in frühen französischen Übersetzungen seiner realitätsnahen Sprache, vieler Charaktere und Handlungsstränge sowie auch der Figur des Geistes zugunsten eines angeblich erhabeneren Stils und einer leichter verdaulichen Handlung mit weniger Toden beraubt worden. Mit Beginn der romantischen Epoche öffnete sich die Tür einen Spalt weit für neue Übersetzungen und Dumas nutzte die Gelegenheit. Sein Schauspiel von 1847 ist in allen Punkten eine Rückbesinnung auf Shakespeares Tragödie. Einzig das französische Ende mit Hamlet auf dem Thron übernahm Dumas.
Für das Londoner Publikum war aber auch dieser Eingriff in das literarische Nationalerbe inakzeptabel. Das originale Ende musste her. Und so konzipierten Thomas, Barbier und Carré 1869 einen neuen Schluss mit sterbendem Hamlet. Auch hier wird das Duell mit Laërte unterbrochen, Hamlet rächt sich an Claudius, ganz ohne Geistererscheinung, und fällt letztlich leblos neben Ophélies Leiche zu Boden. Trotz dieser Fassung für englisches Publikum war die Akzeptanz nur mäßig, denn durch den beigefügten Tod atmete Shakespeares Geist gerade weniger in dieser Version.
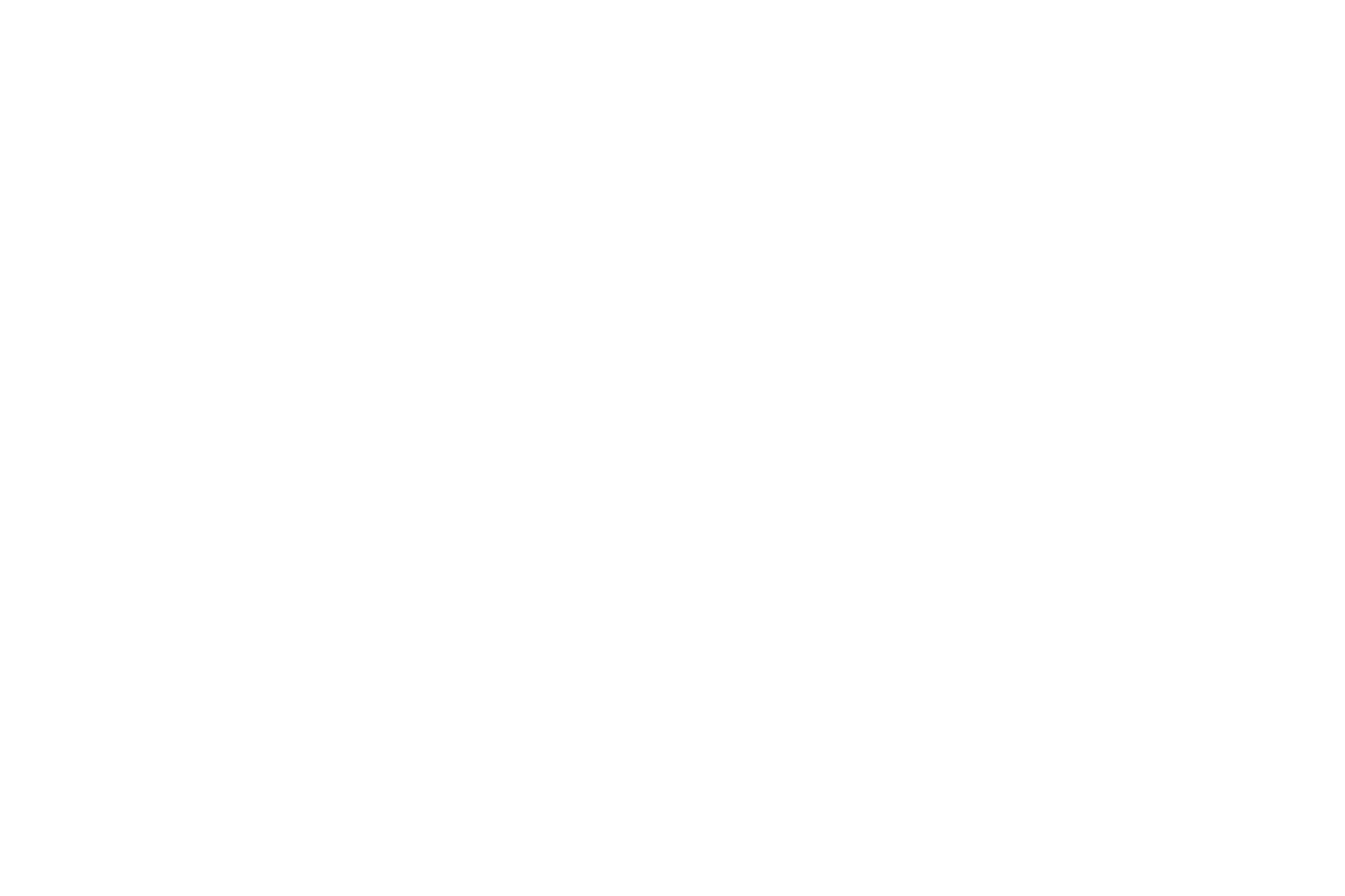
© Monika Rittershaus
Der Sieger
Das »Happy End« von Alexandre Dumas dem Älteren findet seinen Weg von Paris auf die Berliner Bühne – zunächst sogar zur Überraschung von Regisseurin Nadja Loschky. In ihrer Inszenierung liegt der Fokus nicht auf einer Zentralperspektive auf das Geschehen, sondern jede Szene wird aus Hamlets Perspektive erzählt. Dabei denken Loschky und ihr Team Barbiers und Carrés Richtung im Libretto weiter und fügen der Oper noch ein Stückchen mehr Shakespeare hinzu. Liegt es da nicht nahe, ein tragisches Ende mit Hamlets Tod zu wählen?
Das in seiner Essenz auf vier Hauptcharaktere – Hamlet, Ophélie, Gertrude und Claudius – zugeschnittene Libretto stellt die Abfolge der Handlung in den Vordergrund. Ambroise Thomas erkannte die Lücke, die hier für die Musik offen stand und füllte sie mit der Tiefe von Shakespeares Hamlet, seiner inneren Zerrissenheit und der Macht, die der Hof auf ihn ausübt. Thomas’ Musik verleiht der Oper eine emotionale Fallhöhe, die Hamlet durch immer wiederkehrende musikalische Motive an seinen Racheschwur und damit an die höfische Welt, die er im ersten Akt verlassen will, fesselt.
Loschky entlarvt, nicht zuletzt dank dieser Musikdramaturgie, das »Happy End« als eigentlich tragischeres Ende. »Meine Seele steht im Grab und ich bin auf dem Thron.« (»Mon âme est dans la tombe, hélas, et je suis Roi.«) sind Hamlets letzte Worte im vermeintlich guten Ausgang der Oper. Die Welt ist also am Ende nicht heil, Hamlets Konflikt kommt nicht Hollywood-reif zur Auflösung und auch das Paar, durch Irrwege voneinander getrennt, findet hier nicht zueinander. Dieses Mischende zwischen französisch-traditioneller Hamlet-Rezeption, die ihn leben lässt, und dem Einblick in seine Abgründe, den Thomas’ differenzierte, lyrische und tragische Musik bietet, ist ein Bekenntnis für einen Hamlet, dessen Geist an der verdorbenen Welt zerbricht. Für Thomas’ und Loschkys Hamlet läge im Tod die Erlösung. Der Fluch ist das Weiterleben.
Das in seiner Essenz auf vier Hauptcharaktere – Hamlet, Ophélie, Gertrude und Claudius – zugeschnittene Libretto stellt die Abfolge der Handlung in den Vordergrund. Ambroise Thomas erkannte die Lücke, die hier für die Musik offen stand und füllte sie mit der Tiefe von Shakespeares Hamlet, seiner inneren Zerrissenheit und der Macht, die der Hof auf ihn ausübt. Thomas’ Musik verleiht der Oper eine emotionale Fallhöhe, die Hamlet durch immer wiederkehrende musikalische Motive an seinen Racheschwur und damit an die höfische Welt, die er im ersten Akt verlassen will, fesselt.
Loschky entlarvt, nicht zuletzt dank dieser Musikdramaturgie, das »Happy End« als eigentlich tragischeres Ende. »Meine Seele steht im Grab und ich bin auf dem Thron.« (»Mon âme est dans la tombe, hélas, et je suis Roi.«) sind Hamlets letzte Worte im vermeintlich guten Ausgang der Oper. Die Welt ist also am Ende nicht heil, Hamlets Konflikt kommt nicht Hollywood-reif zur Auflösung und auch das Paar, durch Irrwege voneinander getrennt, findet hier nicht zueinander. Dieses Mischende zwischen französisch-traditioneller Hamlet-Rezeption, die ihn leben lässt, und dem Einblick in seine Abgründe, den Thomas’ differenzierte, lyrische und tragische Musik bietet, ist ein Bekenntnis für einen Hamlet, dessen Geist an der verdorbenen Welt zerbricht. Für Thomas’ und Loschkys Hamlet läge im Tod die Erlösung. Der Fluch ist das Weiterleben.
Mehr dazu
18. April 2023
Am Ende dieses außerordentlichen Opernabends herrscht selten erlebter einmütiger Jubel: für die Sänger, die Dirigentin und das Regieteam.
Zum Niederknien schön: Nadja Loschky und Marie Jacquot mit Ambroise Thomas’ »Hamlet« an der Komischen Oper Berlin
Clemens Haustein, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Clemens Haustein, Frankfurter Allgemeine Zeitung
#KOBHamlet
17. April 2023
Mit Hamlet auf Augenhöhe
Warum Thomas Ambroise in seiner Oper Hamlet Orphélie in den Stand der zweiten Hauptfigur erhebt, wie Regisseurin Nadja Loscky dem Grotesken der Tragödie Gewicht verleiht und warum das Werk eine neue Operngattung ins Leben rief – das Wichtigste in Kürze.
#KOBHamlet
Oper
Einführung
17. April 2023
Dreieinhalb Stunden pures Musiktheaterglück... und ein richtiger Inszenierungs-Coup. Wer opulente Oper liebt und sich dieses Spektakel entgehen lässt, ist selbst schuld... Kill for a ticket!
Wiederentdeckung an der Komischen Oper: Ein Triumph für Hamlet - und Ophelia
Frederik Hanssen, Der Tagesspiegel
Frederik Hanssen, Der Tagesspiegel
#KOBHamlet