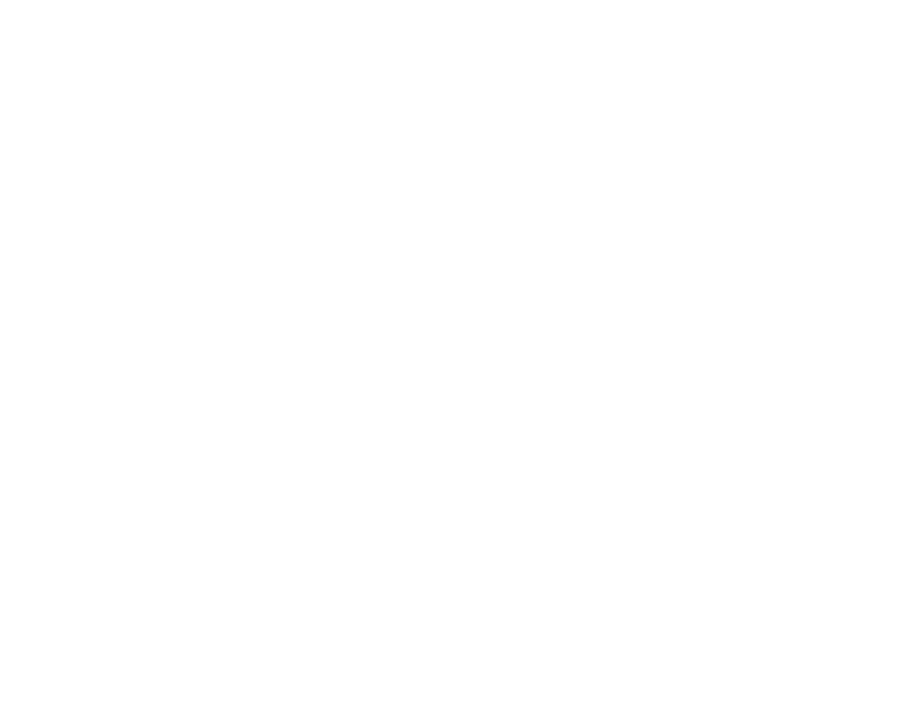© Iko Freese / drama-berlin.de
Magie der Bilder
Theaterzauber, Archetypen und die Faszination des frühen Films in der Inszenierung Die Zauberflöte – von Ulrich Lenz
»Und das Ding wird im Kopf wahrlich fast fertig, wenn es auch lang ist, so dass ich’s hernach mit einem Blick, gleichsam wie ein schönes Bild oder einen hübschen Menschen im Geist übersehe und es auch gar nicht nacheinander, wie es hernach kommen muss, in der Einbildung höre, sondern wie gleich alles zusammen. Alles das Finden und Machen geht in mir nun wie in einem schönen starken Traum vor.« Wolfgang Amadeus Mozart
Seit ihrer Uraufführung am 30. September 1791 in Emanuel Schikaneders Theater im Starhembergschen Freihaus auf der Wieden erfreut sich Die Zauberflöte einer solchen Beliebtheit, dass sie in den Statistiken der Opernhäuser den Rang der meistgespielten deutschen Oper einnimmt. Doch obwohl sie ein breites Publikum, vom Opernneuling bis zum Spezialisten, zu begeistern imstande ist, bleibt sie doch in vielerlei Hinsicht ein Rätsel. Der Zauber ihrer einzigartigen Wirkung will sich einfach nicht greifen lassen. Die Literatur zur Zauberflöte ist ebenso unerschöpflich wie widersprüchlich, doch keiner der unzählbaren Deutungsansätze will am Ende aufgehen.
Schon der Versuch einer gattungsgeschichtlichen Einordnung stellt kein leichtes Unterfangen dar: In die Tradition des Wiener Volkstheaters und seiner Harlekinaden lässt sich das Werk einord-nen, es trägt jedoch auch deutliche Züge der zu jener Zeit so populären Märchen- oder Zauberopern. Mozart selbst nennt es »Große Oper« und benutzt vor allem in den Arien der Königin der Nacht Stilelemente der Opera seria. Die geschilderten Initiationsriten der Eingeweihten um Sarastro legen die Nähe zum Gedankengut der Freimaurer nahe, denen Schikaneder und Mozart angehörten. In diesem Konglomerat aus unterschiedlichsten Einflüssen sieht mancher Exeget nichts als ein fürchterliches Machwerk. Nicht wenige beziehen dies jedoch ausschließlich auf Schikaneders Libretto, während sie Mozart das große Verdienst anrechnen, die »unsägliche« Textvorlage mit seiner Musik veredelt zu haben. Die zahlreichen Quellen, die als Vorlage oder Inspiration gedient haben mögen – u. a. August Jacob Liebeskinds Lulu oder die Zauberflöte, Christoph Martin Wielands Der Stein der Weisen aus der Märchensammlung Dschinnistan, Abbé Jean Terrassons Geschichte des Sethos –, sind bekannt, helfen aber kaum dabei, Licht ins Dunkel des Mysteriums der Zauberflöte und ihrer so einzigartigen Wirkung zu bringen. Auch die so genannte »Bruchtheorie«, nach der Mozart und Schikaneder den Handlungsverlauf ihrer Oper quasi »auf halbem Weg« aufgrund einer zu großen Ähnlichkeit mit der zu jener Zeit im Leopoldstädter Theater gespielten Oper Kaspar, der Fagottist oder Die Zauberzither von Wenzel Müller abänderten und aus der »guten Fee« eine böse Königin der Nacht und aus dem Bösewicht Sarastro einen weisen Herrscher machten, will am Ende nicht recht aufgehen. Jeder Versuch, eine plausible Logik der sprunghaften Handlungsführung zu ergründen oder aber die handelnden Personen der Zauberflöte psychologisch zu deuten, scheint letztlich in einer Sackgasse zu enden.
Schon der Versuch einer gattungsgeschichtlichen Einordnung stellt kein leichtes Unterfangen dar: In die Tradition des Wiener Volkstheaters und seiner Harlekinaden lässt sich das Werk einord-nen, es trägt jedoch auch deutliche Züge der zu jener Zeit so populären Märchen- oder Zauberopern. Mozart selbst nennt es »Große Oper« und benutzt vor allem in den Arien der Königin der Nacht Stilelemente der Opera seria. Die geschilderten Initiationsriten der Eingeweihten um Sarastro legen die Nähe zum Gedankengut der Freimaurer nahe, denen Schikaneder und Mozart angehörten. In diesem Konglomerat aus unterschiedlichsten Einflüssen sieht mancher Exeget nichts als ein fürchterliches Machwerk. Nicht wenige beziehen dies jedoch ausschließlich auf Schikaneders Libretto, während sie Mozart das große Verdienst anrechnen, die »unsägliche« Textvorlage mit seiner Musik veredelt zu haben. Die zahlreichen Quellen, die als Vorlage oder Inspiration gedient haben mögen – u. a. August Jacob Liebeskinds Lulu oder die Zauberflöte, Christoph Martin Wielands Der Stein der Weisen aus der Märchensammlung Dschinnistan, Abbé Jean Terrassons Geschichte des Sethos –, sind bekannt, helfen aber kaum dabei, Licht ins Dunkel des Mysteriums der Zauberflöte und ihrer so einzigartigen Wirkung zu bringen. Auch die so genannte »Bruchtheorie«, nach der Mozart und Schikaneder den Handlungsverlauf ihrer Oper quasi »auf halbem Weg« aufgrund einer zu großen Ähnlichkeit mit der zu jener Zeit im Leopoldstädter Theater gespielten Oper Kaspar, der Fagottist oder Die Zauberzither von Wenzel Müller abänderten und aus der »guten Fee« eine böse Königin der Nacht und aus dem Bösewicht Sarastro einen weisen Herrscher machten, will am Ende nicht recht aufgehen. Jeder Versuch, eine plausible Logik der sprunghaften Handlungsführung zu ergründen oder aber die handelnden Personen der Zauberflöte psychologisch zu deuten, scheint letztlich in einer Sackgasse zu enden.
Die Einheit der Zauberflöte ist ›poetischer‹ Natur. Vergeblich, sie in der psychologischen Folgerichtigkeit oder in einer postulierten Handlungs-Logik zu sehen. In Bruchstücken fällt dann alles auseinander.Stefan Kunze, Mozarts Opern
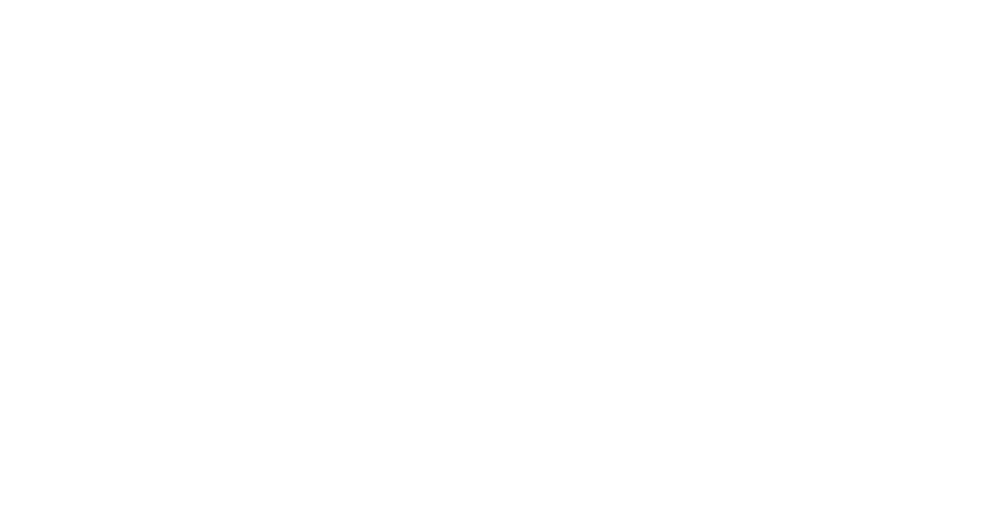
© Iko Freese / drama-berlin.de
» … durch Feuer, Wasser, Luft und Erden « – Theaterzauber in der Zauberflöte
Die Zauberflöte ist eine Oper der Bilder. Ihre Wirkung ist nicht zuletzt der Wirkung ihrer eindrücklichen Bilder geschuldet. Das mag kaum verwundern, war Schikaneders Theater im Freihaus auf der Wieden doch nicht zuletzt für seine wirkungsvollen Bebilderungen und Effekte bekannt und beliebt: »Echte Löwen, Affen und Schlangen kamen auf die Bühne, Berge und Paläste, Kerker und Gärten, Grotten mit Wasserfall, Säulenhallen und Tempel, Donner und Feuer waren die Grundelemente des Bühnenbildes. Es war eine Maschinenoper.« (Tadeusz Krzeszowiak, Freihaustheater in Wien 1787-1801) Im Vorstadttheater auf der Wieden hatte etwas von der Opulenz barocken Ausstattungstheaters mit seinen Verwandlungen, Flugmaschinen, Versenkungen, Feuereffekten, Blitz-, Donner-, Wind- und Regenmaschinen überlebt. »Nicht genug, daß der Direkteur [Schikaneder] die abentheuerlichsten Wesen hier zusammen gruppirt hat, und eine Königin der Nacht – mit ihrer weiblichen Dienerschaft, den Zoroaster mit seinen Priestern, Eingeweihten und Profanen, Geister, Unholde und Furien erscheinen lässt«, heißt es 1793 in einem Kommentar zur Zauberflöte, »sondern er hat das Auge durch sechzehn verschiedene Verwandlungen zu täuschen gesucht, und auf eine barocke Art, die Scenen der Natur herbeigezaubert.« (Johann Friedl, Vertraute Briefe zur Charakteristik von Wien)
In einer »felsigen Gegend, hie und da mit Bäumen überwachsen« beginnt Die Zauberflöte. Beim Auftritt der Königin der Nacht teilen sich laut Regieanweisungen »die Berge auseinander, und das Theater verwandelt sich in ein prächtiges Gemach. Die Königin sitzt auf einem Thron, welcher mit transparenten Sternen geziert ist«. Bereits das Studium der Regieanweisungen im Libretto zur Zauberflöte lässt das bildstarke Bühnenspektakel erahnen, das schließlich in der Szenerie der Feuer- und Wasserprobe kulminiert: »Das Theater verwandelt sich in zwei große Berge: in dem einen ein Wasserfall, worin man sausen und brausen hört; der andere speit Feuer aus; jeder Berg hat ein durchbrochenes Gitter, worin man Feuer und Wasser sieht; da, wo das Feuer brennt, muss der Horizont hellrot sein, und wo das Wasser ist, liegt schwarzer Nebel.«
So nimmt es kaum Wunder, dass die Inszenierungsgeschichte der Zauberflöte nicht zuletzt auch eine Geschichte immer wieder neu gefundener Bildwelten ist. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass es nicht selten Künstler aus dem Bereich der Bildenden Künste sind, die an der Aufführungsgeschichte dieser Oper maßgeblich mitgeschrieben haben: als einer der ersten, nur 25 Jahre nach der Uraufführung, Karl Friedrich Schinkel mit seinen berühmten Entwürfen für die Aufführung an der Hofoper Berlin 1816, im 20. Jahrhundert dann Max Slevogt (Berlin 1928), Oskar Kokoschka (Genf 1965), Marc Chagall (Metropolitan Opera New York 1967), Ernst Fuchs (Hamburgische Staatsoper 1977) und David Hockney (Glyndebourne 1978), um nur ein paar zu nennen.
In einer »felsigen Gegend, hie und da mit Bäumen überwachsen« beginnt Die Zauberflöte. Beim Auftritt der Königin der Nacht teilen sich laut Regieanweisungen »die Berge auseinander, und das Theater verwandelt sich in ein prächtiges Gemach. Die Königin sitzt auf einem Thron, welcher mit transparenten Sternen geziert ist«. Bereits das Studium der Regieanweisungen im Libretto zur Zauberflöte lässt das bildstarke Bühnenspektakel erahnen, das schließlich in der Szenerie der Feuer- und Wasserprobe kulminiert: »Das Theater verwandelt sich in zwei große Berge: in dem einen ein Wasserfall, worin man sausen und brausen hört; der andere speit Feuer aus; jeder Berg hat ein durchbrochenes Gitter, worin man Feuer und Wasser sieht; da, wo das Feuer brennt, muss der Horizont hellrot sein, und wo das Wasser ist, liegt schwarzer Nebel.«
So nimmt es kaum Wunder, dass die Inszenierungsgeschichte der Zauberflöte nicht zuletzt auch eine Geschichte immer wieder neu gefundener Bildwelten ist. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass es nicht selten Künstler aus dem Bereich der Bildenden Künste sind, die an der Aufführungsgeschichte dieser Oper maßgeblich mitgeschrieben haben: als einer der ersten, nur 25 Jahre nach der Uraufführung, Karl Friedrich Schinkel mit seinen berühmten Entwürfen für die Aufführung an der Hofoper Berlin 1816, im 20. Jahrhundert dann Max Slevogt (Berlin 1928), Oskar Kokoschka (Genf 1965), Marc Chagall (Metropolitan Opera New York 1967), Ernst Fuchs (Hamburgische Staatsoper 1977) und David Hockney (Glyndebourne 1978), um nur ein paar zu nennen.
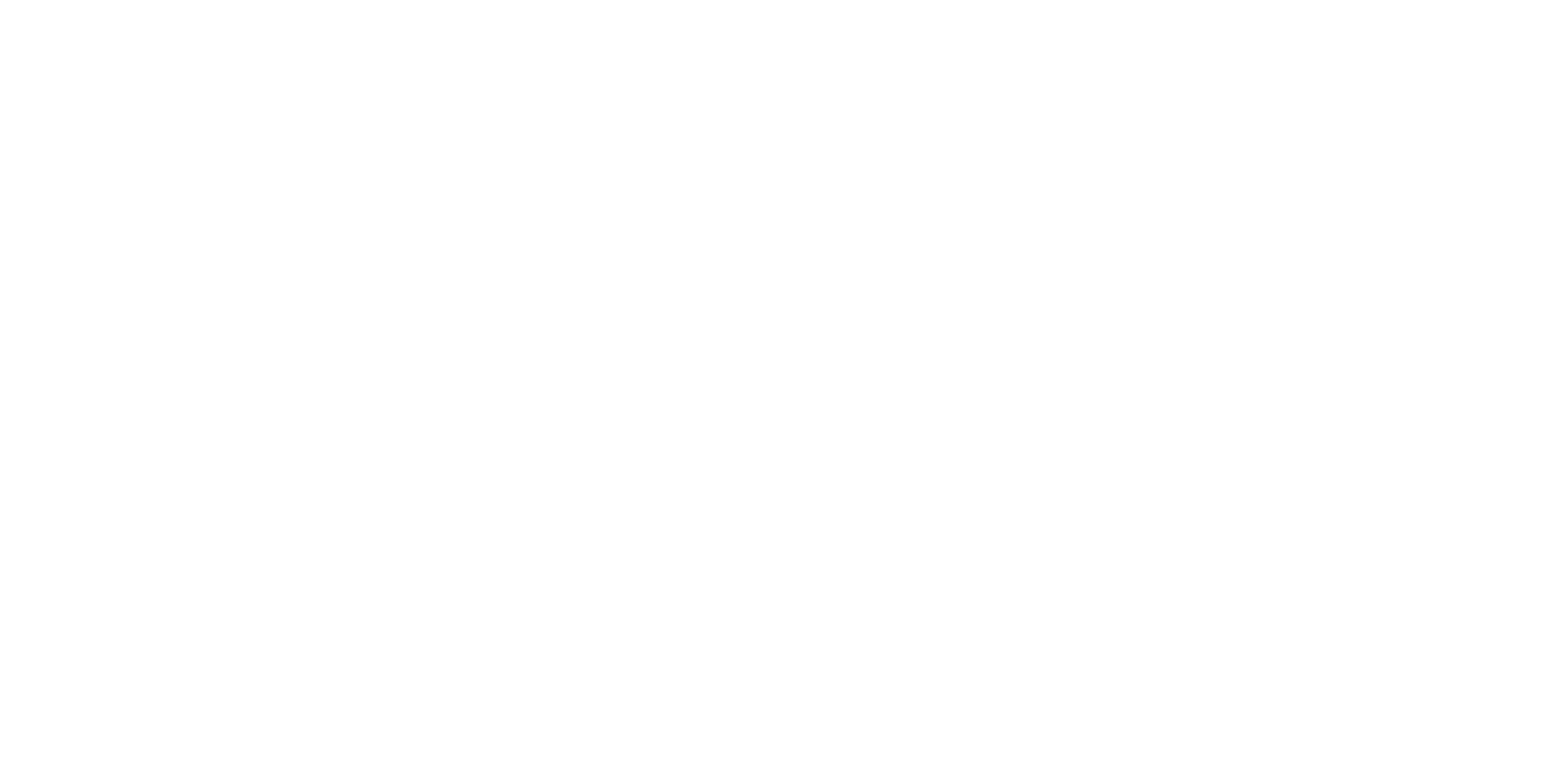
© Iko Freese / drama-berlin.de
»O ewige Nacht, wann wirst du schwinden?« – Eine Reise ins Unbewusste
Es wäre aber ein Irrglaube – und würde der Faszination, die Die Zauberflöte auf ein so breit gefächertes Publikum ausübt, nicht gerecht –, die für das Stück so wichtigen Bildwelten in den Bereich des rein Äußerlichen oder Oberflächlichen abzuschieben. Die Bilder der Zauberflöte scheinen vielmehr Bereiche anzusprechen, die tiefer liegen, als dass sie sich mit reiner Vernunft und Logik erschließen ließen: Der Held im Kampf mit dem Drachen, durch zahlreiche Prüfungen zu innerer Reife gelangend; die mächtige böse Hexe, der gute Zauberer; das (schwarze) Monster, das das unschuldig reine (weiße) Mädchen in seine Gewalt bringen möchte – all das sind archetypische Grundmotive, die seit Tausenden von Jahren im kollektiven Unbewussten der Menschheit schlummern und in Form von Geschichten, Legenden, Sagen und Märchen immer wieder neue Ausformulierungen finden. Und derlei Motive manifestieren sich vor allem in Bildern, die sich in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt haben, ohne dass wir uns dessen bewusst wären. Insofern ist die Frage, bei welchen Quellen sich Schikaneder bedient hat, im Grunde obsolet, denn letztlich speisen sich alle diese in den Bereich der Märchen und Legenden weisenden Vorlagen aus einer viel tiefer im Unterbewussten liegenden, schriftlich nicht fixierten Quelle.
Papageno, ein Verwandter des Hanswursts aus dem Wiener Volkstheater, entspricht dem Archetypus des »komischen Begleiters« an der Seite des (seriösen) Helden (man denke nur an Don Quijote und Sancho Panza oder Don Giovanni und Leporello). In seiner sich durch das ganze Stück ziehenden Sehnsucht nach einem »Mädchen oder Weibchen« trägt er darüber hinaus auch Züge des »traurigen Clowns«, der sich in der Commedia dell’arte als Pagliaccio, in Frankreich als Pierrot nach seiner Colombina bzw. Colombine sehnt und der als »sad tramp« von Charlie Chaplin, noch mehr aber durch die von Buster Keaton kreierte Filmfigur auch auf Zelluloid verewigt wurde.
»Erst wenn wir die Vielschichtigkeit dieses Textes analog der eines Traumes verstehen, in dem mannigfaltige Ebenen des Bewusstseins und des Unbewussten zum Ausdruck kommen, und erst wenn wir auch diejenigen Inhalte als wesentlich erkennen, die sich jenseits von der Absicht des einen einheitlichen Operntext intendierenden Bewusstseins in den Text gewissermaßen eingeschlichen und in ihm durchgesetzt haben, können wir die Tiefgründigkeit der Zauberflöte und des ihr zugrunde liegenden Textes erfassen.« (Erich Neumann, Zur Psychologie des Weiblichen)
Dass diese Tiefgründigkeit dem Direktor eines Vorstadt-theaters, in dem Zauberkomödien, Possen und Märchenopern gespielt wurden, gelungen ist – das wollte und will vielen Exegeten der Zauberflöte nicht in den Kopf. Ob die rätselhafte Tiefgründigkeit des Librettos zur Zauberflöte nun das Ergebnis eines eher unbewussten Schöpfungsaktes ist oder nicht – gerade dass manches nicht zusammenpassen will, gerade dass die einzelnen Charaktere sich nicht in einer klaren Richtung deuten lassen, gerade dass die klaren Abgrenzungen zwischen Gut und Böse immer wieder zu verschwimmen scheinen, eben dies macht den großen Reiz und die faszinierende Rätselhaftigkeit dieser Oper aus.
Papageno, ein Verwandter des Hanswursts aus dem Wiener Volkstheater, entspricht dem Archetypus des »komischen Begleiters« an der Seite des (seriösen) Helden (man denke nur an Don Quijote und Sancho Panza oder Don Giovanni und Leporello). In seiner sich durch das ganze Stück ziehenden Sehnsucht nach einem »Mädchen oder Weibchen« trägt er darüber hinaus auch Züge des »traurigen Clowns«, der sich in der Commedia dell’arte als Pagliaccio, in Frankreich als Pierrot nach seiner Colombina bzw. Colombine sehnt und der als »sad tramp« von Charlie Chaplin, noch mehr aber durch die von Buster Keaton kreierte Filmfigur auch auf Zelluloid verewigt wurde.
»Erst wenn wir die Vielschichtigkeit dieses Textes analog der eines Traumes verstehen, in dem mannigfaltige Ebenen des Bewusstseins und des Unbewussten zum Ausdruck kommen, und erst wenn wir auch diejenigen Inhalte als wesentlich erkennen, die sich jenseits von der Absicht des einen einheitlichen Operntext intendierenden Bewusstseins in den Text gewissermaßen eingeschlichen und in ihm durchgesetzt haben, können wir die Tiefgründigkeit der Zauberflöte und des ihr zugrunde liegenden Textes erfassen.« (Erich Neumann, Zur Psychologie des Weiblichen)
Dass diese Tiefgründigkeit dem Direktor eines Vorstadt-theaters, in dem Zauberkomödien, Possen und Märchenopern gespielt wurden, gelungen ist – das wollte und will vielen Exegeten der Zauberflöte nicht in den Kopf. Ob die rätselhafte Tiefgründigkeit des Librettos zur Zauberflöte nun das Ergebnis eines eher unbewussten Schöpfungsaktes ist oder nicht – gerade dass manches nicht zusammenpassen will, gerade dass die einzelnen Charaktere sich nicht in einer klaren Richtung deuten lassen, gerade dass die klaren Abgrenzungen zwischen Gut und Böse immer wieder zu verschwimmen scheinen, eben dies macht den großen Reiz und die faszinierende Rätselhaftigkeit dieser Oper aus.
»O so eine Flöte …« – Orpheus und die Zauberflöte
Tamino und Papageno, der Prinz und der Naturmensch, und ihre weiblichen Pendants Pamina und Papagena; der seine Gefühle bis zur Unkenntlichkeit kontrollierende Sarastro und der triebgesteuerte Monostatos – es sind Paarungen des Bewussten und Unbewussten, der Vernunft und des Triebhaften, die uns in den Figuren der Zauberflöte begegnen, ohne dass Mozart mit seiner Musik der einen oder anderen Seite den Vorzug gäbe. Eine Paarung anderer Art bilden hingegen Sarastro und die Königin der Nacht: In ihrem Kampf um den Einfluss auf Tamino und Pamina wirken beide wie ins Monströse gesteigerte, einem Albtraum entsprungene Vater- und Mutterfiguren. Dabei lässt sich die Königin der Nacht durchaus im Sinne von Carl Gustav Jungs Archetyp der »Großen Mutter« deuten, deren Ambivalenz zwischen der »gütigen, hegenden, tragenden« und der »verschlingenden, verführenden, vergiftenden, angsterregenden« Mutter in den beiden Arien der Königin eindrucksvoll zum Ausdruck kommt.
Derlei mythologisch-psychologische Bezüge lassen sich beinahe endlos fortsetzen: Taminos Reise durch Sarastros Reich der Prüfungen trägt Züge der archetypischen Reise des Helden in die Unterwelt, die Jung als »Nachtmeerfahrt« bezeichnet hat. Die Reise der Sonne, die im Westen im Meer untergeht und stirbt und – gewandelt – im Osten wiedergeboren wird, ist dabei Vorbild für die Reise des Helden, dessen Bewusstsein sich im Kampf gegen die dunklen Mächte des Unbewussten zu bewähren hat, der durch die Nacht zum Licht, zur Erleuchtung gelangt.
Die ihm mit auf seine Reise in die Unterwelt der Prüfungen gegebene Zauberflöte fügt Tamino noch eine weitere Dimension hinzu, indem sie ihn in die Nähe des vielleicht berühmtesten »Nachtmeerfahrers« der griechischen Mythologie rückt: Wie der thrakische Sänger Orpheus mit seinem Gesang die belebte und unbelebte Natur zu rühren imstande ist, so bleibt auch Taminos Flötenspiel nicht ohne Wirkung. Wie Orpheus erhofft sich auch Tamino am Ende seiner Reise die (Wieder-)Vereinigung mit der Geliebten, die er erst nach Überwindung zahlreicher Hindernisse und Prüfungen erlangen kann. Die vielleicht härteste dieser Prüfungen – Stillschweigen gegenüber der Geliebten zu bewahren – ist der entscheidende Moment, an dem Orpheus auf seinem Weg zurück aus der Unterwelt scheitert und so die geliebte Eurydike auf immer verliert. Diese dramatische Situation erscheint in der Zauberflöte sogar noch gesteigert, wenn Pamina, die nichts vom Schweigegebot Taminos weiß, immer verzweifelter um eine Reaktion des Geliebten fleht. Im Gegensatz zu Orpheus hält sich Tamino jedoch strikt an das auf-erlegte Verbot. Schließlich kann Pamina Taminos Verhalten nur als Zurückweisung deuten. In der Zauberflöte ist es am Ende dieser entscheidenden Szene nicht Orpheus/Tamino, der über den Verlust der Liebe klagt, sondern Eurydike/Pamina.
Während Orpheus’ Instrument in erster Linie die eigene Stimme ist (auch wenn er sich selbst auf seiner Lyra begleitet), Mensch und Musik also zu einer Einheit verschmelzen, rückt Taminos Flöte allein die Musik in den Mittelpunkt des von ihr ausgehenden Zaubers. Jener Zauber ist denn auch nichts anderes als die Macht, die Musik auf Menschen auszuüben imstande ist: »Hiermit kannst du allmächtig handeln«, singen die drei Damen, »Der Menschen Leidenschaft verwandeln. / Der Traurige wird freudig sein, / Den Hagestolz nimmt Liebe ein.«
Derlei mythologisch-psychologische Bezüge lassen sich beinahe endlos fortsetzen: Taminos Reise durch Sarastros Reich der Prüfungen trägt Züge der archetypischen Reise des Helden in die Unterwelt, die Jung als »Nachtmeerfahrt« bezeichnet hat. Die Reise der Sonne, die im Westen im Meer untergeht und stirbt und – gewandelt – im Osten wiedergeboren wird, ist dabei Vorbild für die Reise des Helden, dessen Bewusstsein sich im Kampf gegen die dunklen Mächte des Unbewussten zu bewähren hat, der durch die Nacht zum Licht, zur Erleuchtung gelangt.
Die ihm mit auf seine Reise in die Unterwelt der Prüfungen gegebene Zauberflöte fügt Tamino noch eine weitere Dimension hinzu, indem sie ihn in die Nähe des vielleicht berühmtesten »Nachtmeerfahrers« der griechischen Mythologie rückt: Wie der thrakische Sänger Orpheus mit seinem Gesang die belebte und unbelebte Natur zu rühren imstande ist, so bleibt auch Taminos Flötenspiel nicht ohne Wirkung. Wie Orpheus erhofft sich auch Tamino am Ende seiner Reise die (Wieder-)Vereinigung mit der Geliebten, die er erst nach Überwindung zahlreicher Hindernisse und Prüfungen erlangen kann. Die vielleicht härteste dieser Prüfungen – Stillschweigen gegenüber der Geliebten zu bewahren – ist der entscheidende Moment, an dem Orpheus auf seinem Weg zurück aus der Unterwelt scheitert und so die geliebte Eurydike auf immer verliert. Diese dramatische Situation erscheint in der Zauberflöte sogar noch gesteigert, wenn Pamina, die nichts vom Schweigegebot Taminos weiß, immer verzweifelter um eine Reaktion des Geliebten fleht. Im Gegensatz zu Orpheus hält sich Tamino jedoch strikt an das auf-erlegte Verbot. Schließlich kann Pamina Taminos Verhalten nur als Zurückweisung deuten. In der Zauberflöte ist es am Ende dieser entscheidenden Szene nicht Orpheus/Tamino, der über den Verlust der Liebe klagt, sondern Eurydike/Pamina.
Während Orpheus’ Instrument in erster Linie die eigene Stimme ist (auch wenn er sich selbst auf seiner Lyra begleitet), Mensch und Musik also zu einer Einheit verschmelzen, rückt Taminos Flöte allein die Musik in den Mittelpunkt des von ihr ausgehenden Zaubers. Jener Zauber ist denn auch nichts anderes als die Macht, die Musik auf Menschen auszuüben imstande ist: »Hiermit kannst du allmächtig handeln«, singen die drei Damen, »Der Menschen Leidenschaft verwandeln. / Der Traurige wird freudig sein, / Den Hagestolz nimmt Liebe ein.«
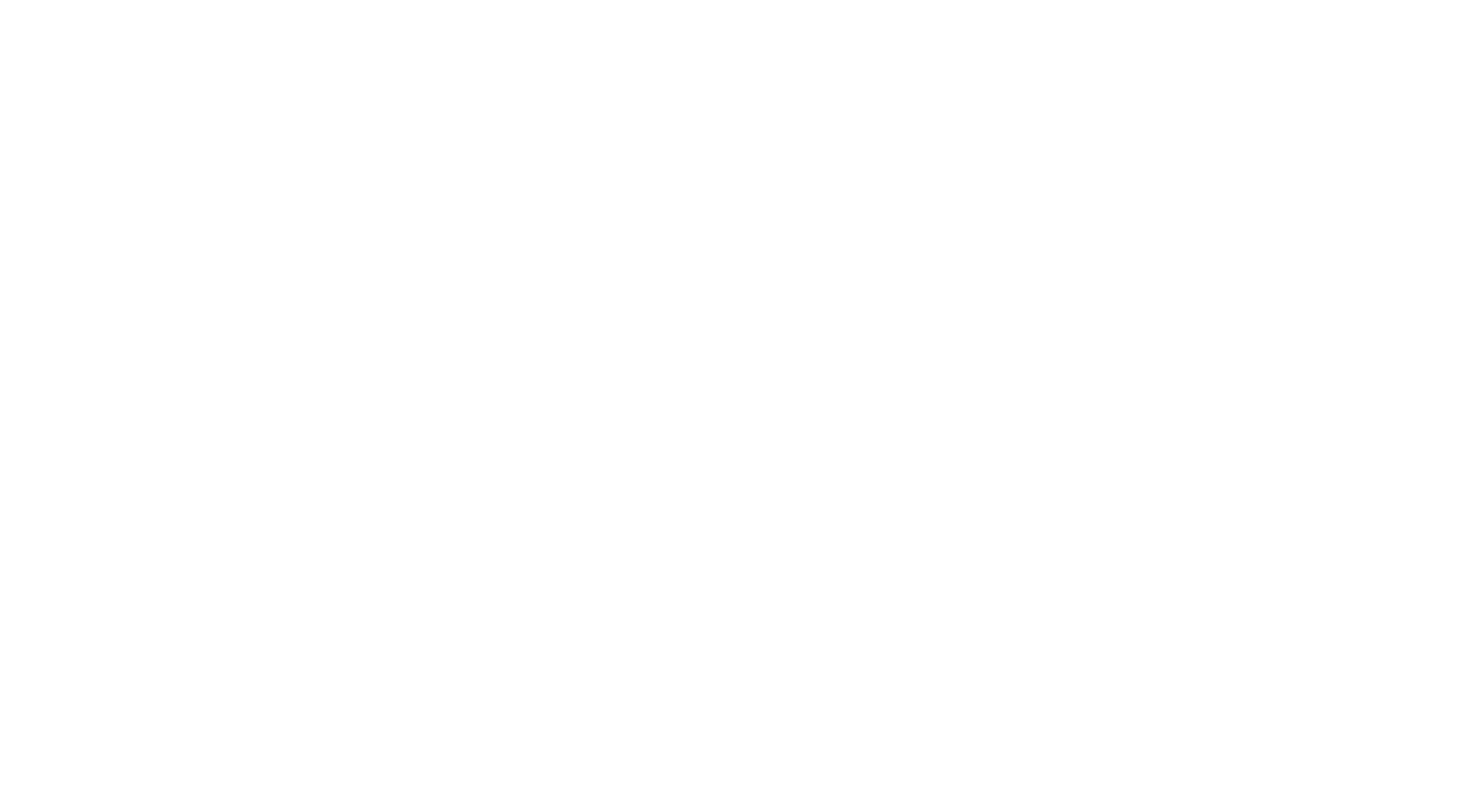
© Iko Freese / drama-berlin.de
»Dies Bildnis ist bezaubernd schön« – Auf der Suche nach der Traumfrau
Die Zauberflöte ist eine Oper der Bilder. Und das nicht nur in ihrer Wirkung auf das Publikum, sondern ebenso innerhalb des Werkes selbst. Denn ein Bild ist letztlich Auslöser der gesamten Handlung: das Bild Paminas, das Tamino von den drei Damen erhält und das ihn sofort in Liebe zu der Dargestellten entbrennen lässt. Diese Liebe ist der Motor für sein weiteres Handeln. Einmal mehr zeigt sich darin die faszinierende Tiefgründigkeit der Bilder in der Zauberflöte: Wer liebt, macht sich unweigerlich ein Bild des geliebten Menschen, das jedoch nur selten mit der Realität übereinstimmt. Dieses dem eigenen Wunschdenken entsprungene Bild nach und nach mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen, gehört zu den »Prüfungen«, die jede Liebe zu durchlaufen hat.
»Desto mehr wird geträumt, je weniger bereits erlebt ist. Vor allem Liebe malt das Ihre stets früher, als sie es hat. Sie stellt sich die Eine, den Einen vage vor, bevor das dadurch liebenswerte Geschöpf leibhaftig aufgetreten ist. Ein Blick, ein Umriss, eine Art zu gehen, wird geträumt, so müsste die Erwählte aussehen, um eine zu sein. Die geliebten Züge schweben bildhaft vor, und der äußere Reiz muss ihnen gemäß sein, sonst kann er nicht als ein zu liebender zünden. […] Vieles bleibt hier inwendig, ein Traum von dem, was man nicht kennt oder was noch nicht erreichbar ist. Der Traum mit dem Bild darin wird lange, ja allein geliebt.« Ernst Bloch, Prinzip Hoffnung
Auch Papageno wird von einem Bild geleitet, das jedoch allein in seiner Fantasie existiert. Erst ganz am Ende der Oper findet er die Frau, die er sich so lange in den schönsten Farben ausgemalt hat: Papagena. Oder bleibt doch alles nur ein Traum? Der Traum vom »Traumpartner«, der genau so ist, wie man ihn sich vorgestellt hat?
»Desto mehr wird geträumt, je weniger bereits erlebt ist. Vor allem Liebe malt das Ihre stets früher, als sie es hat. Sie stellt sich die Eine, den Einen vage vor, bevor das dadurch liebenswerte Geschöpf leibhaftig aufgetreten ist. Ein Blick, ein Umriss, eine Art zu gehen, wird geträumt, so müsste die Erwählte aussehen, um eine zu sein. Die geliebten Züge schweben bildhaft vor, und der äußere Reiz muss ihnen gemäß sein, sonst kann er nicht als ein zu liebender zünden. […] Vieles bleibt hier inwendig, ein Traum von dem, was man nicht kennt oder was noch nicht erreichbar ist. Der Traum mit dem Bild darin wird lange, ja allein geliebt.« Ernst Bloch, Prinzip Hoffnung
Auch Papageno wird von einem Bild geleitet, das jedoch allein in seiner Fantasie existiert. Erst ganz am Ende der Oper findet er die Frau, die er sich so lange in den schönsten Farben ausgemalt hat: Papagena. Oder bleibt doch alles nur ein Traum? Der Traum vom »Traumpartner«, der genau so ist, wie man ihn sich vorgestellt hat?
»Ihr Götter! Welch ein Augenblick!« – Die Geburt des Märchens aus dem Geiste des Films
Wir leben in einer Zeit der Bilderfluten. Bewegte und unbewegte Bilder stürmen tagtäglich aus Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen, aus Fernsehern, Bildschirmen und Monitoren auf uns ein, im Büro, auf der Straße, im Kaufhaus oder zu Hause. Angesichts dieser Übersättigung scheint uns die unmittelbare Faszination an den Bildern beinahe abhanden gekommen zu sein, jene Faszination, wie sie die Menschen vergangener Jahrhunderte beim Betrachten des reichen Bilder- und Figurenschmucks der Kirchen und Kathedralen oder eben die Besucher von Schikaneders Freihaustheater empfunden haben müssen. Das letzte Mal, dass der moderne Mensch von einer derartigen Faszination gepackt wurde, war möglicherweise vor etwas mehr als 100 Jahren, als »die Bilder laufen lernten«. Die allerersten Filme sind Zeugnisse dieser Faszination, sie erzählen noch keine Geschichte, sondern erfreuen sich allein an der Wieder-gabe kurzer bewegter Momente alltäglichen Lebens.
Als sich dann aus diesen ersten Versuchen vor allem im Berlin der 1910er und 20er Jahre eine neue Kunstgattung entwickelte, sorgte das anfängliche Fehlen des Tons für eine Konzentration auf die Kraft der Bilder. Nicht von ungefähr gehören ausgerechnet die Stummfilme jener Jahre bis heute zum Experimentellsten, was auf dem Gebiet des Films geschaffen wurde. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Tatsache, dass nicht etwa Zwischentitel, sondern zuallererst die Bilder selbst der Aufgabe gerecht werden mussten, den fehlenden Ton zu ersetzen. Paul Wegener, Regisseur des international gefeierten Stummfilm-Klassikers Der Golem, wie er in die Welt kam (1920), beklagt sich 1916 über die zunehmende Praxis, allzu schnell auf Zwischentitel zurückzugreifen: »Man gibt sich gar nicht einmal mehr die Mühe, bildmäßig zu gestalten. […] Alles an Aktion spielt sich im Text ab, und das nennen die Leute einen Film!« Und noch 1929 mahnt Friedrich Kohner an, der Film solle auf derlei »Inszenationskrücken« verzichten lernen. Gleichzeitig wurde immer wieder auch versucht, die Zwischentitel zu einem Bestandteil der Bildwelten des Films zu machen – durch die Verwendung unterschiedlicher Schrifttypen oder durch gestaltete Hintergründe. Wie der fehlende Ton so förderte auch die fehlende Farbe eine Konzen-tration auf das Bild an sich, auf Licht und Schatten, hell und dunkel, auf Silhouetten, menschliche Profile und architektonische Besonderheiten des jeweiligen Settings. (Dass die meisten Stummfilme ursprünglich monochrom eingefärbt waren, spricht dem nicht entgegen.)
Es war sicherlich kein Zufall, dass die zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufkommende Psychoanalyse, die sich mit den archetypischen Bildern im menschlichen Unterbewusstsein zu beschäftigen begann, auch die Bildwelten der neuen Kunstgattung Film stark beeinflusste. »Mit der Erfindung des kinematischen Lichtbildes, das als nicht greifbares Abbild einer scheinbaren Realität ebenso schnell aufleuchtet, wie es gleich wieder verschwindet, geriet Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts die Entdeckung der Seele als geheimnisvolles und unfassbares Phänomen an die Öffentlichkeit. Der Kinoraum konnte innere Zustände, Ängste und Begierden sichtbar machen, der Film war damit die ideale Form ihrer direkten Verbildlichung.« (Babette Richter, Die stumme Verführung) Friedrich Wilhelm Murnaus Nosferatu (1922) oder Robert Wienes Das Cabinet des Dr. Caligari (1920), zwei frühe Meisterwerke des Horrorfilms, sind eindrucksvolle Zeugnisse dafür, wie der Film neue Bildwelten für die menschlichen Abgründe des Unterbewussten suchte und fand.
Bereits in den frühen Jahren des Films entstand eine weitere Form der bewegten Bilder, die keine Menschen in Bewegung ablichtet, sondern die Bewegung aus sich selbst heraus durch das Zusammensetzen von Einzelbildern zu einem Bewegungsablauf erschafft und dabei ganz ohne Menschen auskommt: der Animationsfilm. Führend in dieser neuen Gattung ist abermals Berlin, wo Lotte Reiniger 1926 mit ihrem Scherenschnitt-Film Die Abenteuer des Prinzen Achmed den ersten abendfüllenden Animationsfilm der Filmgeschichte präsentiert. »Unbeschwert von den Bedingtheiten
der Realität, die jeden Märchenglauben im Realfilm so leicht töten und die etwa Walt Disney im Streben nach naturalistischer Perfek-tion in seine Märchenfilme einbrachte, erleben wir in den Filmen der Lotte Reiniger die Geburt des Märchens aus dem Geiste des Films.« (Hartmut W. Redottée)
Als sich dann aus diesen ersten Versuchen vor allem im Berlin der 1910er und 20er Jahre eine neue Kunstgattung entwickelte, sorgte das anfängliche Fehlen des Tons für eine Konzentration auf die Kraft der Bilder. Nicht von ungefähr gehören ausgerechnet die Stummfilme jener Jahre bis heute zum Experimentellsten, was auf dem Gebiet des Films geschaffen wurde. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Tatsache, dass nicht etwa Zwischentitel, sondern zuallererst die Bilder selbst der Aufgabe gerecht werden mussten, den fehlenden Ton zu ersetzen. Paul Wegener, Regisseur des international gefeierten Stummfilm-Klassikers Der Golem, wie er in die Welt kam (1920), beklagt sich 1916 über die zunehmende Praxis, allzu schnell auf Zwischentitel zurückzugreifen: »Man gibt sich gar nicht einmal mehr die Mühe, bildmäßig zu gestalten. […] Alles an Aktion spielt sich im Text ab, und das nennen die Leute einen Film!« Und noch 1929 mahnt Friedrich Kohner an, der Film solle auf derlei »Inszenationskrücken« verzichten lernen. Gleichzeitig wurde immer wieder auch versucht, die Zwischentitel zu einem Bestandteil der Bildwelten des Films zu machen – durch die Verwendung unterschiedlicher Schrifttypen oder durch gestaltete Hintergründe. Wie der fehlende Ton so förderte auch die fehlende Farbe eine Konzen-tration auf das Bild an sich, auf Licht und Schatten, hell und dunkel, auf Silhouetten, menschliche Profile und architektonische Besonderheiten des jeweiligen Settings. (Dass die meisten Stummfilme ursprünglich monochrom eingefärbt waren, spricht dem nicht entgegen.)
Es war sicherlich kein Zufall, dass die zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufkommende Psychoanalyse, die sich mit den archetypischen Bildern im menschlichen Unterbewusstsein zu beschäftigen begann, auch die Bildwelten der neuen Kunstgattung Film stark beeinflusste. »Mit der Erfindung des kinematischen Lichtbildes, das als nicht greifbares Abbild einer scheinbaren Realität ebenso schnell aufleuchtet, wie es gleich wieder verschwindet, geriet Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts die Entdeckung der Seele als geheimnisvolles und unfassbares Phänomen an die Öffentlichkeit. Der Kinoraum konnte innere Zustände, Ängste und Begierden sichtbar machen, der Film war damit die ideale Form ihrer direkten Verbildlichung.« (Babette Richter, Die stumme Verführung) Friedrich Wilhelm Murnaus Nosferatu (1922) oder Robert Wienes Das Cabinet des Dr. Caligari (1920), zwei frühe Meisterwerke des Horrorfilms, sind eindrucksvolle Zeugnisse dafür, wie der Film neue Bildwelten für die menschlichen Abgründe des Unterbewussten suchte und fand.
Bereits in den frühen Jahren des Films entstand eine weitere Form der bewegten Bilder, die keine Menschen in Bewegung ablichtet, sondern die Bewegung aus sich selbst heraus durch das Zusammensetzen von Einzelbildern zu einem Bewegungsablauf erschafft und dabei ganz ohne Menschen auskommt: der Animationsfilm. Führend in dieser neuen Gattung ist abermals Berlin, wo Lotte Reiniger 1926 mit ihrem Scherenschnitt-Film Die Abenteuer des Prinzen Achmed den ersten abendfüllenden Animationsfilm der Filmgeschichte präsentiert. »Unbeschwert von den Bedingtheiten
der Realität, die jeden Märchenglauben im Realfilm so leicht töten und die etwa Walt Disney im Streben nach naturalistischer Perfek-tion in seine Märchenfilme einbrachte, erleben wir in den Filmen der Lotte Reiniger die Geburt des Märchens aus dem Geiste des Films.« (Hartmut W. Redottée)
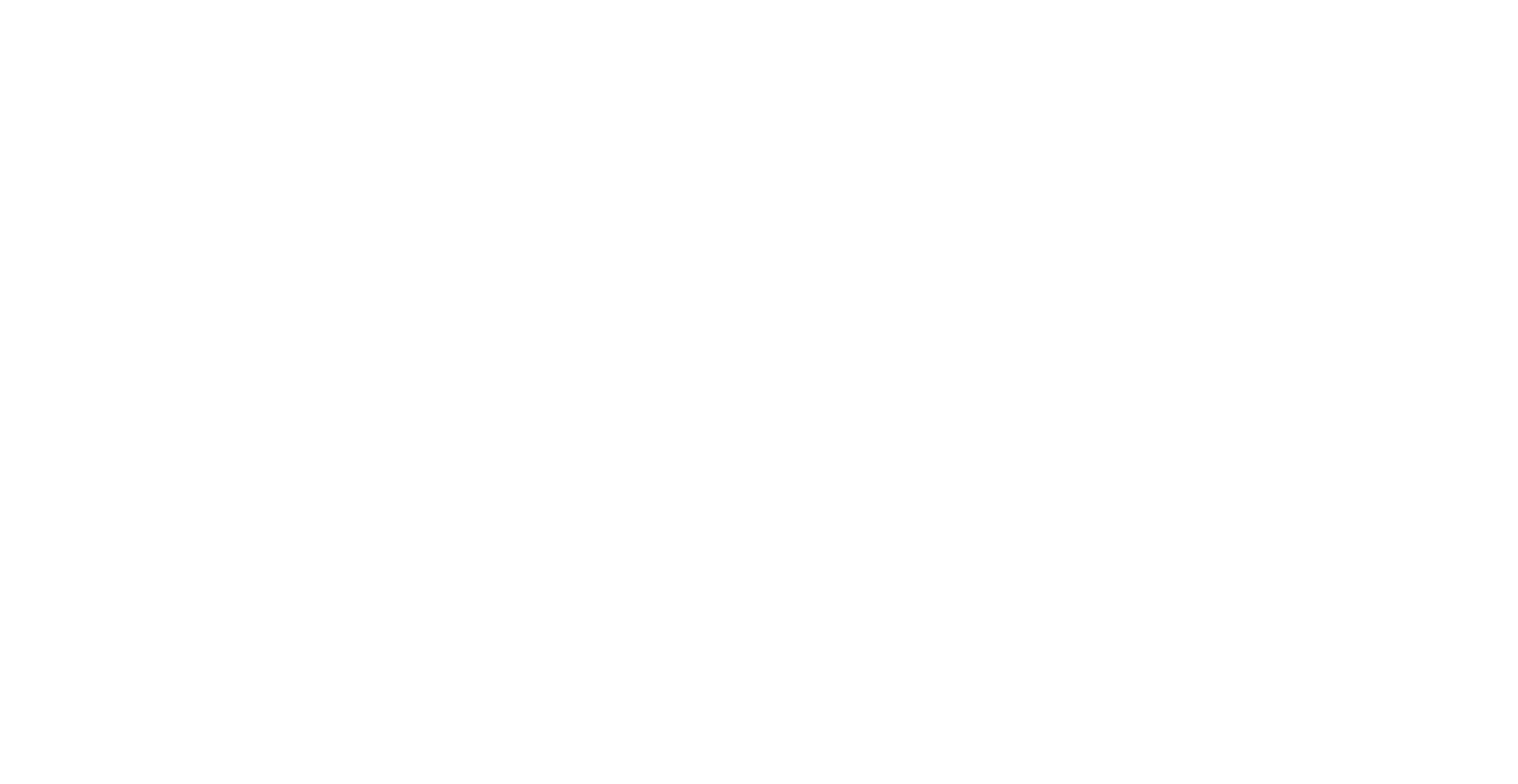
© Iko Freese / drama-berlin.de
»Das klinget so herrlich, das klinget so schön!« – Die passende Musik zu einem »buntscheckigen« Stück
Die Zauberflöte ist eine Oper der Bilder. Ganz unterschied-liche Welten treffen in diesen Bildern aufeinander. Mozart reagiert darauf, indem er sehr disparate musikalische Welten, vom Strophenlied zur hochdramatischen Opera-seria-Arie, von der Fuge zum homophonen Chorsatz, nebeneinander stellt – und damit eben nicht das üble »Machwerk« Schikaneders veredelt, sondern vielmehr die jeweils passende Musik zu den so verschiedenartigen Bildern zu finden scheint.
»Nehmen wir die Frage wieder auf, was eigentlich die heterogenen Elemente, die sich einer damals lebendigen Theater-tradition letztlich zwanglos einfügten – die Buntscheckigkeit gehörte wesentlich zum Wiener Vorstadttheater und zur ›Maschinen-Komödie‹ –, zusammenschließt, dann bleibt wohl nur eine Antwort: Mozarts Musik. Mit ihrer Spannweite umfasst sie ebenso die Papageno-Sphäre wie die feierlichen Szenen der Sarastro-Welt.« Stefan Kunze, Mozarts Opern
Mozart selbst hielt jedenfalls viel auf seine letzte Oper und sah in ihr sicherlich mehr als nur oberflächliches Bildertheater. Davon zeugt u. a. sein Ärger über das Verhalten eines Bekannten beim Besuch einer Zauberflöten-Vorstellung: »Unglückseeligerweise war ich eben drinnen als der 2:te Ackt anfieng, folglich bey der feyerlichen Scene. – er belachte alles; anfangs hatte ich gedult genug ihn auf einige Reden aufmerksam machen zu wollen; allein – er belachte alles: da wards mir nun zu viel – ich hiess ihn Papageno und gieng fort.« Stolz berichtet Mozart über das positive Urteil seines Komponistenkollegen Antonio Salieri: »Er hörte und sah mit aller Aufmerksamkeit und von der Sinfonie bis zum letzten Chor, war kein Stück, welches ihm nicht ein bravo oder bello entlockte.« Und an seine Frau Constanze schreibt er am 7. Oktober 1791: »Eben komme ich von der Oper – Sie war eben so voll wie allzeit. […] – was mich aber am meisten freuet, ist, der Stille beifall! – man sieht recht wie sehr und immer mehr diese Oper steigt.«
Die Zauberflöte ist eine Oper der Bilder. Was hinter oder unter diesen Bildern liegt, lässt sich mit Worten nur unzureichend benennen, findet seinen passenderen Ausdruck in der Welt des Märchens, in der Welt der Träume – und in der Welt der Musik. In ihrer Rätselhaftigkeit und in der Faszination ihrer Bilder liegt der Reiz, den sie bis heute auf Opernbesucher unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft ausübt.
»Nehmen wir die Frage wieder auf, was eigentlich die heterogenen Elemente, die sich einer damals lebendigen Theater-tradition letztlich zwanglos einfügten – die Buntscheckigkeit gehörte wesentlich zum Wiener Vorstadttheater und zur ›Maschinen-Komödie‹ –, zusammenschließt, dann bleibt wohl nur eine Antwort: Mozarts Musik. Mit ihrer Spannweite umfasst sie ebenso die Papageno-Sphäre wie die feierlichen Szenen der Sarastro-Welt.« Stefan Kunze, Mozarts Opern
Mozart selbst hielt jedenfalls viel auf seine letzte Oper und sah in ihr sicherlich mehr als nur oberflächliches Bildertheater. Davon zeugt u. a. sein Ärger über das Verhalten eines Bekannten beim Besuch einer Zauberflöten-Vorstellung: »Unglückseeligerweise war ich eben drinnen als der 2:te Ackt anfieng, folglich bey der feyerlichen Scene. – er belachte alles; anfangs hatte ich gedult genug ihn auf einige Reden aufmerksam machen zu wollen; allein – er belachte alles: da wards mir nun zu viel – ich hiess ihn Papageno und gieng fort.« Stolz berichtet Mozart über das positive Urteil seines Komponistenkollegen Antonio Salieri: »Er hörte und sah mit aller Aufmerksamkeit und von der Sinfonie bis zum letzten Chor, war kein Stück, welches ihm nicht ein bravo oder bello entlockte.« Und an seine Frau Constanze schreibt er am 7. Oktober 1791: »Eben komme ich von der Oper – Sie war eben so voll wie allzeit. […] – was mich aber am meisten freuet, ist, der Stille beifall! – man sieht recht wie sehr und immer mehr diese Oper steigt.«
Die Zauberflöte ist eine Oper der Bilder. Was hinter oder unter diesen Bildern liegt, lässt sich mit Worten nur unzureichend benennen, findet seinen passenderen Ausdruck in der Welt des Märchens, in der Welt der Träume – und in der Welt der Musik. In ihrer Rätselhaftigkeit und in der Faszination ihrer Bilder liegt der Reiz, den sie bis heute auf Opernbesucher unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft ausübt.
Mehr dazu
8. März 2023
Plappergeno
In Plappergeno, unserem lebendigen Podcast für neugierige Ohren, stellen wir uns spannenden Fragen rund um Kinderlieder und was sie uns erzählen. Wie wird Speiseeis hergestellt? Warum heulen Wölfe den Mond an? Und welche Länder hat eine Weltenbummlerin bereist? Unsere Gesprächspartner:innen haben die Antwort. Hört doch mal rein!
Jung für alle
#KOBZauberflöte
16. Februar 2020
Auf dem Spielplan der Komischen Oper feiert die ›Zauberflöte‹ dieser Tage wieder ihre Liebeserklärung an den Stummfilm. Eine grandiose Erfolgsgeschichte.
Komische Oper geht ins Kino
Sybill Mahlke, Der Tagesspiegel
Sybill Mahlke, Der Tagesspiegel
#KOBZauberflöte