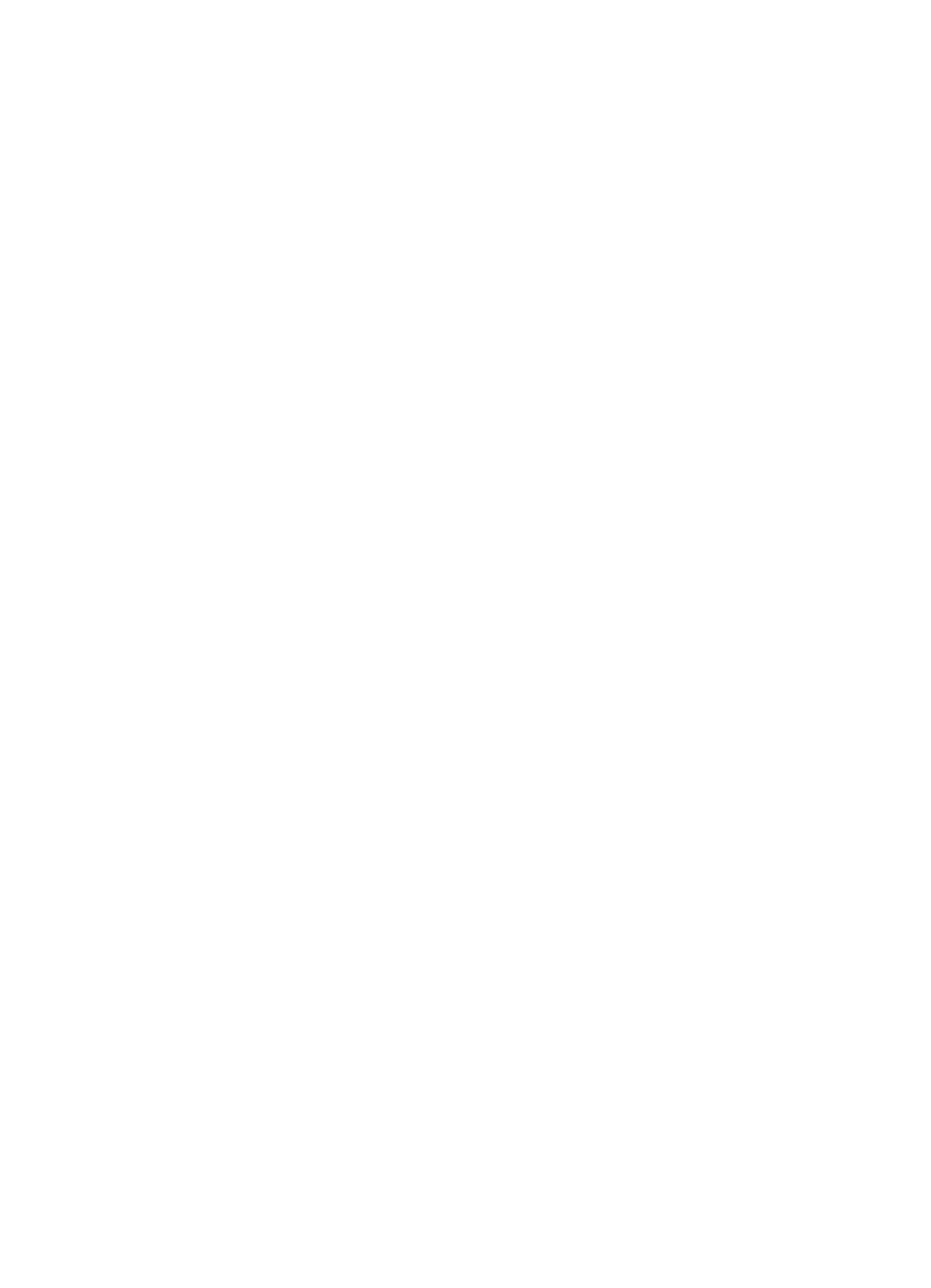© Jaro Suffner
Es lohnt, zu kämpfen!
Regisseur Tobias Kratzer und Dirigent Titus Engel sprechen über den Tod, die Hoffnung und die Notwendigkeit, für sein eigenes Stückchen Leben zu kämpfen.
Im Titel ihres Werks beziehen sich Hans Werner Henze und Ernst Schnabel auf Théodore Géricaults Gemälde Le Radeau de La Méduse aus dem Jahr 1819, das seinerzeit für einen politischen Skandal sorgte. Was war an diesem Gemälde so anstößig?
Tobias Kratzer: Géricaults Gemälde ist keine Ölskizze oder ein Radie- rungszyklus, sondern große Historienmalerei. Darin liegt seine kunsthisto- rische Bedeutung, denn dieses überlebensgroße Format und diese künst- lerische Vollendung waren bisher quasi nur biblischen oder historischen Themen vorbehalten. Géricault widmet sich aber einem tagespolitischen Ereignis in voller Größe und auch Henze komponiert keine kleine Etüde über den Schrecken, sondern tritt musikalisch mit dem Anspruch des großen Tafelbildes auf.
Titus Engel: Géricaults dicker Pinsel ist auch bei Henzes Wahl einer großen Besetzung und kontrastreicher Dynamiken zu spüren, die vom extremen Fortissimo ins zarte Pianissimo wechseln. Ebenso wie Géricault wollten Henze und Schnabel die Menschen auf dem Floß in ihrer Schönheit darstellen, statt sie fremd wirken zu lassen. Eine Identifizierung und Solidarisierung mit den Menschen auf dem Floß der »Medusa« sollte möglich sein.
Tobias Kratzer: Géricaults Gemälde ist keine Ölskizze oder ein Radie- rungszyklus, sondern große Historienmalerei. Darin liegt seine kunsthisto- rische Bedeutung, denn dieses überlebensgroße Format und diese künst- lerische Vollendung waren bisher quasi nur biblischen oder historischen Themen vorbehalten. Géricault widmet sich aber einem tagespolitischen Ereignis in voller Größe und auch Henze komponiert keine kleine Etüde über den Schrecken, sondern tritt musikalisch mit dem Anspruch des großen Tafelbildes auf.
Titus Engel: Géricaults dicker Pinsel ist auch bei Henzes Wahl einer großen Besetzung und kontrastreicher Dynamiken zu spüren, die vom extremen Fortissimo ins zarte Pianissimo wechseln. Ebenso wie Géricault wollten Henze und Schnabel die Menschen auf dem Floß in ihrer Schönheit darstellen, statt sie fremd wirken zu lassen. Eine Identifizierung und Solidarisierung mit den Menschen auf dem Floß der »Medusa« sollte möglich sein.
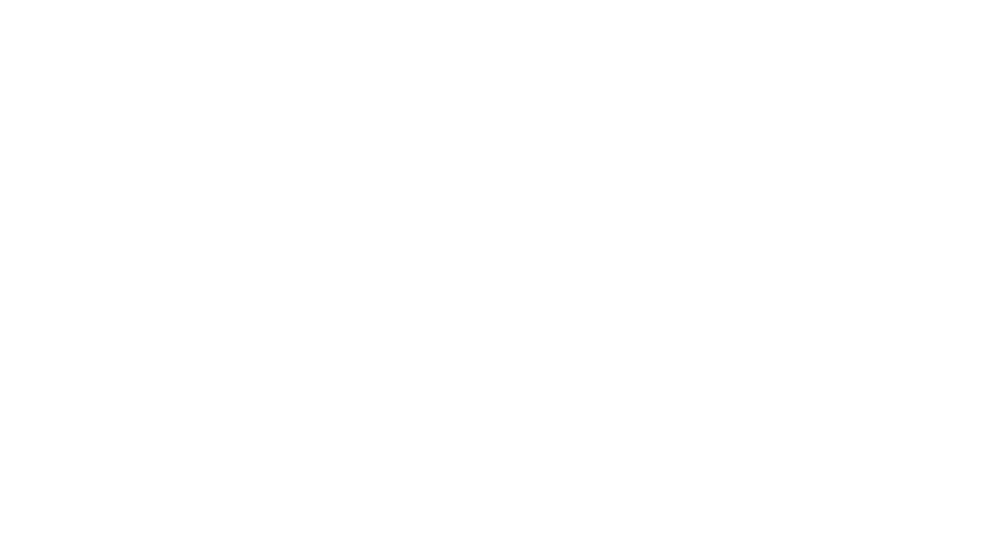
© Jaro Suffner
Drei Hauptfiguren neben über hundert Chorsolisten, Knabencho- risten und Komparsen handeln das Geschehen untereinander aus. Eine von ihnen, Jean-Charles, befindet sich mit 154 weiteren Zurückgelassenen auf dem Floß.
Tobias Kratzer: Jean-Charles verkörpert den Primus inter Pares, der jeder von uns sein könnte, fast ein Jedermann im Hofmannsthal’schen Sinne. Er ist zunächst zwar weder durch seine soziale Position, noch durch sein Charakterprofil allzu deutlich hervorgehoben, doch gerade dadurch wird er uns zur Identifikationsfigur. Im Verlauf des Werkes gewinnt er dann mehr und mehr an Kontur. Jean-Charles lässt sich nicht sofort von der allgegen- wärtigen Brutalität anstecken, die auf dem Floß stattfindet, sondern verkörpert die Stimme der Vernunft und der Menschlichkeit. Außerdem ist er der Einzige, der La Mort sehen kann, wobei man nicht weiß, ob er dem Wahnsinn nahe ist oder der eigentlich Hellsichtigste unter den Lebenden ist. Am Ende gibt es die bittere und tragische Pointe, dass gerade er, der als Erster das rettende Schiff entdeckt, zu diesem Zeitpunkt bereits im Fieber liegt und stirbt.
Die Figur La Mort stellt sich mit den Worten vor: »Ich bin die wandellose Stille eurer Ziele, und erste Liebe hat mich einst gemacht.« Rätselhafte, wenn auch schöne Worte. Was bedeutet der Tod in dieser Inszenierung?
Tobias Kratzer: Der Tod bedeutet Selbstaufgabe. La Mort verkörpert ein verführerisches Gefährdungspotential: Es kann manchmal schlicht einfacher sein, aufzugeben, nicht zu kämpfen und mit etwas abzuschließen, anstatt sich immer wieder ins Leben zu werfen und sich für seine Ziele einzusetzen. Das ist das Fatale an dieser Gestalt, die die Lebenden mit musikalischen Mitteln umschmeichelt und verführt, doch dabei eine trügerische Alternative bietet.
Wie legt Hans Werner Henze diese Figuren musikalisch an?
Titus Engel: Die beiden Partien sind kompositorisch diametral entgegen- gesetzt angelegt. La Mort kommen die großen elegischen Phrasen zu, wobei sie und das Totenreich meist von Streichern begleitet werden. Hinzu kommen unglaubliche Spitzentöne, denn Henze hat die Partie für sehr hohen Sopran komponiert, der zugleich auch Tiefe, also einen weiten Stimmumfang besitzen muss. Dadurch steht La Mort eine große Aus- drucksvielfalt zur Verfügung. Für die Rolle des Jean-Charles sieht Henze Sprechgesang, aber auch experimentelle Gesangsmomente vor, wie z. B. ein Stottern oder Glissandi, also kontinuierlich gleitende Veränderungen der Tonhöhe. Im Gegensatz zu La Mort werden ihm wenige zusammenhängen- de Gesangslinien zuteil, vielmehr liegt seine Vokallinie meist viel kleinteili- ger. Dadurch unterstützt Henze die Nervosität und Dramatik, die diese Figur transportiert. Durch die rasche Abfolge von Sprechgesang und Kantilenen ändert sich auch der szenische Charakter schnell.
Tobias Kratzer: Jean-Charles verkörpert den Primus inter Pares, der jeder von uns sein könnte, fast ein Jedermann im Hofmannsthal’schen Sinne. Er ist zunächst zwar weder durch seine soziale Position, noch durch sein Charakterprofil allzu deutlich hervorgehoben, doch gerade dadurch wird er uns zur Identifikationsfigur. Im Verlauf des Werkes gewinnt er dann mehr und mehr an Kontur. Jean-Charles lässt sich nicht sofort von der allgegen- wärtigen Brutalität anstecken, die auf dem Floß stattfindet, sondern verkörpert die Stimme der Vernunft und der Menschlichkeit. Außerdem ist er der Einzige, der La Mort sehen kann, wobei man nicht weiß, ob er dem Wahnsinn nahe ist oder der eigentlich Hellsichtigste unter den Lebenden ist. Am Ende gibt es die bittere und tragische Pointe, dass gerade er, der als Erster das rettende Schiff entdeckt, zu diesem Zeitpunkt bereits im Fieber liegt und stirbt.
Die Figur La Mort stellt sich mit den Worten vor: »Ich bin die wandellose Stille eurer Ziele, und erste Liebe hat mich einst gemacht.« Rätselhafte, wenn auch schöne Worte. Was bedeutet der Tod in dieser Inszenierung?
Tobias Kratzer: Der Tod bedeutet Selbstaufgabe. La Mort verkörpert ein verführerisches Gefährdungspotential: Es kann manchmal schlicht einfacher sein, aufzugeben, nicht zu kämpfen und mit etwas abzuschließen, anstatt sich immer wieder ins Leben zu werfen und sich für seine Ziele einzusetzen. Das ist das Fatale an dieser Gestalt, die die Lebenden mit musikalischen Mitteln umschmeichelt und verführt, doch dabei eine trügerische Alternative bietet.
Wie legt Hans Werner Henze diese Figuren musikalisch an?
Titus Engel: Die beiden Partien sind kompositorisch diametral entgegen- gesetzt angelegt. La Mort kommen die großen elegischen Phrasen zu, wobei sie und das Totenreich meist von Streichern begleitet werden. Hinzu kommen unglaubliche Spitzentöne, denn Henze hat die Partie für sehr hohen Sopran komponiert, der zugleich auch Tiefe, also einen weiten Stimmumfang besitzen muss. Dadurch steht La Mort eine große Aus- drucksvielfalt zur Verfügung. Für die Rolle des Jean-Charles sieht Henze Sprechgesang, aber auch experimentelle Gesangsmomente vor, wie z. B. ein Stottern oder Glissandi, also kontinuierlich gleitende Veränderungen der Tonhöhe. Im Gegensatz zu La Mort werden ihm wenige zusammenhängen- de Gesangslinien zuteil, vielmehr liegt seine Vokallinie meist viel kleinteili- ger. Dadurch unterstützt Henze die Nervosität und Dramatik, die diese Figur transportiert. Durch die rasche Abfolge von Sprechgesang und Kantilenen ändert sich auch der szenische Charakter schnell.
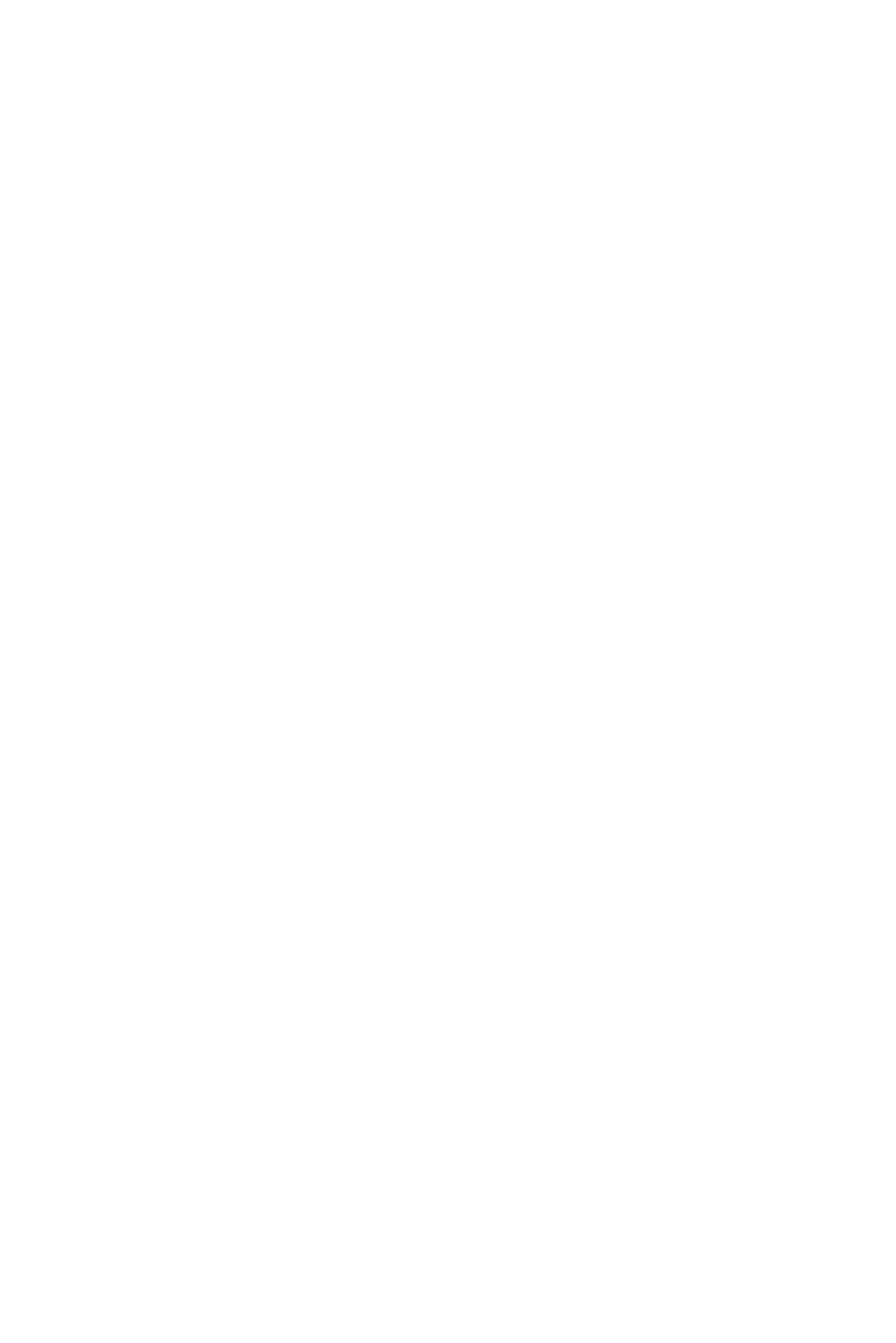
© Jaro Suffner
Wie in barocken Oratorien führt eine Erzählfigur durch das Geschehen. Sie trägt den Namen des mythischen Fährmanns Charon.
Tobias Kratzer: Die Motivik des Fährmanns kommt in unserer Inszenie- rung zwar auch vor, da Charon sich am Beginn im Boot fortbewegt, nicht aber im Sinne des Mittlers zwischen der Welt der gerade Gestorbenen und der Totenwelt. Eigentlich ist Charon eine neutrale Erzählstimme – traditionell männlich besetzt, bei uns von einer Opernsängerin darge- stellt. Charon steckt im Dilemma des Betrachters. Charon versucht, das Geschehen neutral zu betrachten, kann aber nie vollständig unbeteiligt sein. Denn allein durch das Zusehen kann man sich schuldig machen und zu einer Haltung gegenüber den Ereignissen gezwungen werden. Als einzelne:r Betrachter:in kann man einer Massenpanik oft nichts anderes als Empathie entgegensetzen. Charon gerät also immer wieder in Situationen, in die auch wir als Anteilnehmende geraten, wenn wir manchmal helfen möchten, manchmal fassungslos außen vor sind. Manchmal denken wir, im Kleinen etwas bewirken zu können, was Einzelnen hilft, aber die Gesamtsituation können wir nicht verändern.
Auch der Erzählfigur Charon nimmt sich Henze kompositorisch an …
Titus Engel: Charon spricht Texte mal frei, mal rhythmisch, mal skandiert sie auf frei wählbaren Tonhöhen. Henze komponiert aber auch Verdunk- lungen und Aufhellungen der Stimme Charons und entwirft somit eine Partie, die zwischen Schauspiel und Gesang liegt. Dabei steht Charon in einem starken Dialog mit dem Orchester, insbesondere den zwölf Perkussionisten. Henzes rhythmische Sprache ist vielfältiger als die seiner Zeitgenossen Karlheinz Stockhausen und Pierre Boulez, deren serielle Kompositionen den rhythmischen Puls aufgeben und die den Rhythmus als Reihe betrachteten, die Klangflächen entstehen ließ. Bei Hans Werner Henze spielen pulsierende Rhythmen aber eine große Rolle, gerade in den dramatischen Nummern zum Schluss hin, in denen die Katastrophe auf dem Floß immer existentieller wird.
Henze wollte kein Dogmatiker sein, sah die systematische Zwölf- tonmusik als nicht optimale Musiksprache und Kommunikations- strategie, und trotzdem bedient er sich ihrer. Worin liegt die Besonderheit in seiner kompositorischen Herangehensweise?
Titus Engel: In einer Zwölftonreihe werden alle zwölf chromatische Töne gleichwertig benutzt. Tatsächlich komponiert Henze für Das Floß der Medusa eine Grundreihe mit zwölf Tönen, die er im Verlauf des Orato- riums transponiert, umkehrt und deren Intervalle er als Krebs bearbeitet, also in die entgegengesetzte Richtung aufschreibt. Streng genommen wird in der Zwölftonmusik ein jeder der Töne einmal gespielt, bevor man wieder von vorne beginnen kann, was Henze ganz zu Anfang des Oratoriums auch befolgt. Dann wird die Komposition aber freier und man merkt, dass die Technik für ihn zunächst nur eine Möglichkeit ist, die Tonhöhen jenseits des tonalen Systems zu organisieren; beispielsweise im Duett zwischen Jean-Charles und La Mort, in dem die Zwölftonreihe eine größere Rolle spielt, er sich aber, wenn nötig, davon befreit. Im Finale verwendet er sogar eine sechzigtönige Melodie, die er mit Hilfe eines zwölfton-ähnlichen Verfahrens konstruiert. Sie klingt aber gar nicht abstrakt, sondern sehr elegisch. Darin erkennt man den Theatermenschen, dem es mehr um die szenische Situation als um die dogmatische Setzung ging.
Tobias Kratzer: Die Motivik des Fährmanns kommt in unserer Inszenie- rung zwar auch vor, da Charon sich am Beginn im Boot fortbewegt, nicht aber im Sinne des Mittlers zwischen der Welt der gerade Gestorbenen und der Totenwelt. Eigentlich ist Charon eine neutrale Erzählstimme – traditionell männlich besetzt, bei uns von einer Opernsängerin darge- stellt. Charon steckt im Dilemma des Betrachters. Charon versucht, das Geschehen neutral zu betrachten, kann aber nie vollständig unbeteiligt sein. Denn allein durch das Zusehen kann man sich schuldig machen und zu einer Haltung gegenüber den Ereignissen gezwungen werden. Als einzelne:r Betrachter:in kann man einer Massenpanik oft nichts anderes als Empathie entgegensetzen. Charon gerät also immer wieder in Situationen, in die auch wir als Anteilnehmende geraten, wenn wir manchmal helfen möchten, manchmal fassungslos außen vor sind. Manchmal denken wir, im Kleinen etwas bewirken zu können, was Einzelnen hilft, aber die Gesamtsituation können wir nicht verändern.
Auch der Erzählfigur Charon nimmt sich Henze kompositorisch an …
Titus Engel: Charon spricht Texte mal frei, mal rhythmisch, mal skandiert sie auf frei wählbaren Tonhöhen. Henze komponiert aber auch Verdunk- lungen und Aufhellungen der Stimme Charons und entwirft somit eine Partie, die zwischen Schauspiel und Gesang liegt. Dabei steht Charon in einem starken Dialog mit dem Orchester, insbesondere den zwölf Perkussionisten. Henzes rhythmische Sprache ist vielfältiger als die seiner Zeitgenossen Karlheinz Stockhausen und Pierre Boulez, deren serielle Kompositionen den rhythmischen Puls aufgeben und die den Rhythmus als Reihe betrachteten, die Klangflächen entstehen ließ. Bei Hans Werner Henze spielen pulsierende Rhythmen aber eine große Rolle, gerade in den dramatischen Nummern zum Schluss hin, in denen die Katastrophe auf dem Floß immer existentieller wird.
Henze wollte kein Dogmatiker sein, sah die systematische Zwölf- tonmusik als nicht optimale Musiksprache und Kommunikations- strategie, und trotzdem bedient er sich ihrer. Worin liegt die Besonderheit in seiner kompositorischen Herangehensweise?
Titus Engel: In einer Zwölftonreihe werden alle zwölf chromatische Töne gleichwertig benutzt. Tatsächlich komponiert Henze für Das Floß der Medusa eine Grundreihe mit zwölf Tönen, die er im Verlauf des Orato- riums transponiert, umkehrt und deren Intervalle er als Krebs bearbeitet, also in die entgegengesetzte Richtung aufschreibt. Streng genommen wird in der Zwölftonmusik ein jeder der Töne einmal gespielt, bevor man wieder von vorne beginnen kann, was Henze ganz zu Anfang des Oratoriums auch befolgt. Dann wird die Komposition aber freier und man merkt, dass die Technik für ihn zunächst nur eine Möglichkeit ist, die Tonhöhen jenseits des tonalen Systems zu organisieren; beispielsweise im Duett zwischen Jean-Charles und La Mort, in dem die Zwölftonreihe eine größere Rolle spielt, er sich aber, wenn nötig, davon befreit. Im Finale verwendet er sogar eine sechzigtönige Melodie, die er mit Hilfe eines zwölfton-ähnlichen Verfahrens konstruiert. Sie klingt aber gar nicht abstrakt, sondern sehr elegisch. Darin erkennt man den Theatermenschen, dem es mehr um die szenische Situation als um die dogmatische Setzung ging.
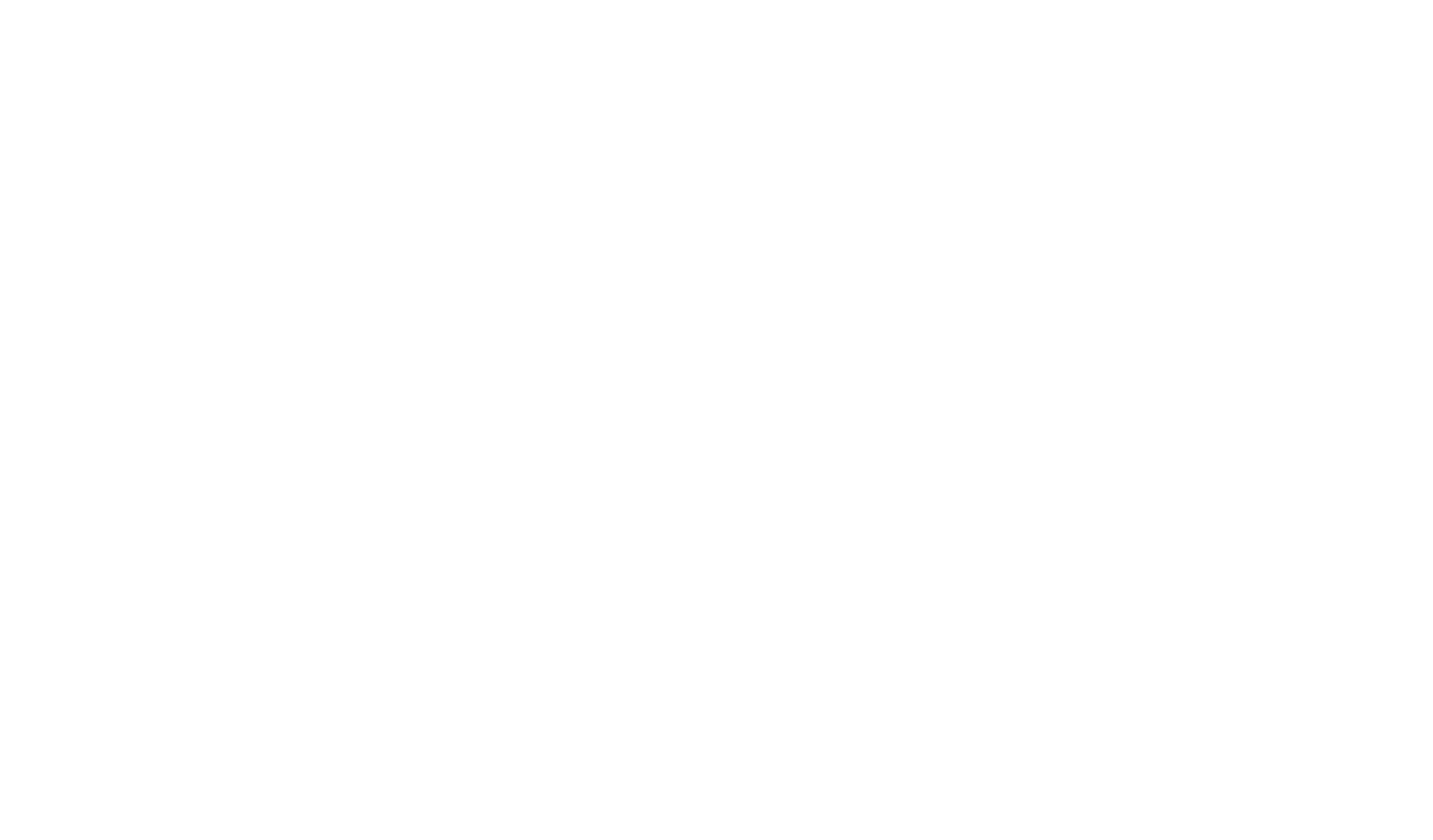
© Jaro Suffner
Henzes Komposition strahlt eine gewaltige Emotionalität aus. Was macht sie so direkt und packend?
Titus Engel: Die Grundsetzung ist simpel: Die Musik des Totenreichs steht mit ihren elegischen Gesangspassagen auf Italienisch, die direkt Dante Alighieris Göttlicher Komödie entliehen sind, der agitierten Musik der Lebenden auf dem Floß entgegen. Während die Toten von den Blasinstrumenten, die symbolhaft ihren Atem unterstreichen, unterstützt werden, begleiten die Streicher die Toten. Hinzu kommen energievolle Chorpassagen, beispielsweise im dramatischen Moment, wenn das Schiff »Medusa« auf das Riff fährt. Die reflexiven Momente Charons bilden dazu einen Kontrast. Diese Bandbreite von Musiksprachen, die derart logisch mit der Dramaturgie des Werks übereinstimmen, verleihen ihm eine große Direktheit.
Das Floß der Medusa wurde in vergangenen Inszenierungen oftmals mit tagespolitischen Ereignissen in Verbindung gebracht, wie etwa mit der sich 2015 zuspitzenden sogenannten »Flüchtlingskrise«.
Tobias Kratzer: Will man einen übergreifenden Begriff für die Thematik des Stückes finden, könnte man auch von Ressourcenknappheit sprechen, die einerseits das Klassenproblem und andererseits die Verknappung von bewohnbarem Lebensraum umfasst. Im Oratorium geht es um die Ressour- cen Nahrung und Wasser auf diesem zum Floß geschrumpften Schiff. Als Parabel spiegelt das Oratorium ein Problem, das sich nicht auf eine Gesellschaftsschicht allein beschränkt, sondern ein systemisches ist. Aber das Floß ist natürlich – wie viele Schiffe in der Literatur und in der Musikgeschichte – eine Metapher. Das Stück geht somit einen Schritt über den realpolitischen Kontext hinaus und offenbart die Verlorenheit des Men- schen, es ist universell.
Hans Werner Henze und Librettist Ernst Schnabel lassen die Toten nicht gänzlich verstummen, sondern lassen sie mit den Lebenden kommunizieren. Einige Überlebende kehren in die Welt zurück, »belehrt von Wirklichkeit, fiebernd sie umzustürzen«. Ist Das Floß der Medusa hoffnungsvoll?
Titus Engel: Kurz bevor man stirbt, singt man nicht mehr, allenfalls ein Hauch ist noch zu hören. Für die Toten aber komponiert Henze wunderschöne Linien. Im Sterbensmoment wandelt sich also die Musiksprache und enthält eine Mischung aus barocker Rhythmik und Harmonik des 20. Jahrhundert, die auch einen romantischen Anklang haben kann.
Tobias Kratzer: Es ist aber trügerisch, sich dem Schönen hinzugeben, denn in ihm schwingt die Ruhe des Meeres als Grabstätte mit. Das Werk ist gerade dann hoffnungsvoll, wenn man sich nicht dem verführerischen Tod hingibt, sondern wenn man sich rhythmisch dagegenstemmt. Auch wenn das Überwindung kostet – und im Übrigen schwieriger zu singen ist – so zeigt es doch, dass es sich zu leben lohnt.
Titus Engel: Die Hoffnung liegt auch in der Tatsache, dass es realhistorisch Überlebende gab, die die Kunde der Katastrophe auf dem Floß weitertru- gen und einen gesellschaftlichen Skandal auslösten. Das Werk greift das auf und zeigt: Es lohnt sich, für eine Sache einzustehen und um das Leben zu kämpfen … schon damit die Geschichte der Toten nicht vergessen wird.
Titus Engel: Die Grundsetzung ist simpel: Die Musik des Totenreichs steht mit ihren elegischen Gesangspassagen auf Italienisch, die direkt Dante Alighieris Göttlicher Komödie entliehen sind, der agitierten Musik der Lebenden auf dem Floß entgegen. Während die Toten von den Blasinstrumenten, die symbolhaft ihren Atem unterstreichen, unterstützt werden, begleiten die Streicher die Toten. Hinzu kommen energievolle Chorpassagen, beispielsweise im dramatischen Moment, wenn das Schiff »Medusa« auf das Riff fährt. Die reflexiven Momente Charons bilden dazu einen Kontrast. Diese Bandbreite von Musiksprachen, die derart logisch mit der Dramaturgie des Werks übereinstimmen, verleihen ihm eine große Direktheit.
Das Floß der Medusa wurde in vergangenen Inszenierungen oftmals mit tagespolitischen Ereignissen in Verbindung gebracht, wie etwa mit der sich 2015 zuspitzenden sogenannten »Flüchtlingskrise«.
Tobias Kratzer: Will man einen übergreifenden Begriff für die Thematik des Stückes finden, könnte man auch von Ressourcenknappheit sprechen, die einerseits das Klassenproblem und andererseits die Verknappung von bewohnbarem Lebensraum umfasst. Im Oratorium geht es um die Ressour- cen Nahrung und Wasser auf diesem zum Floß geschrumpften Schiff. Als Parabel spiegelt das Oratorium ein Problem, das sich nicht auf eine Gesellschaftsschicht allein beschränkt, sondern ein systemisches ist. Aber das Floß ist natürlich – wie viele Schiffe in der Literatur und in der Musikgeschichte – eine Metapher. Das Stück geht somit einen Schritt über den realpolitischen Kontext hinaus und offenbart die Verlorenheit des Men- schen, es ist universell.
Hans Werner Henze und Librettist Ernst Schnabel lassen die Toten nicht gänzlich verstummen, sondern lassen sie mit den Lebenden kommunizieren. Einige Überlebende kehren in die Welt zurück, »belehrt von Wirklichkeit, fiebernd sie umzustürzen«. Ist Das Floß der Medusa hoffnungsvoll?
Titus Engel: Kurz bevor man stirbt, singt man nicht mehr, allenfalls ein Hauch ist noch zu hören. Für die Toten aber komponiert Henze wunderschöne Linien. Im Sterbensmoment wandelt sich also die Musiksprache und enthält eine Mischung aus barocker Rhythmik und Harmonik des 20. Jahrhundert, die auch einen romantischen Anklang haben kann.
Tobias Kratzer: Es ist aber trügerisch, sich dem Schönen hinzugeben, denn in ihm schwingt die Ruhe des Meeres als Grabstätte mit. Das Werk ist gerade dann hoffnungsvoll, wenn man sich nicht dem verführerischen Tod hingibt, sondern wenn man sich rhythmisch dagegenstemmt. Auch wenn das Überwindung kostet – und im Übrigen schwieriger zu singen ist – so zeigt es doch, dass es sich zu leben lohnt.
Titus Engel: Die Hoffnung liegt auch in der Tatsache, dass es realhistorisch Überlebende gab, die die Kunde der Katastrophe auf dem Floß weitertru- gen und einen gesellschaftlichen Skandal auslösten. Das Werk greift das auf und zeigt: Es lohnt sich, für eine Sache einzustehen und um das Leben zu kämpfen … schon damit die Geschichte der Toten nicht vergessen wird.
Mehr dazu
17. September 2023
Eine grandiose Musiktheater-Produktion, die in die Annalen der Komischen Oper eingehen wird.
»Das Floß der Medusa«: Die Hoffnung stirbt zuletzt
Volker Blech, Berliner Morgenpost
Volker Blech, Berliner Morgenpost
#KOBMedusa
17. September 2023
Mit dem szenisch aufbereiteten Oratorium 'Das Floß der Medusa' von Hans Werner Henze hat sich die Komische Oper Berlin eine glanzvolle erste Premiere dieser Spielzeit verschafft. … Sinnigerweise zeigt sie, dass Heimatlosigkeit eine Chance sein kann, ein Ausnahmezustand auch ungeahnte Kräfte freisetzt.
… Titus Engel leitet das Riesenorchester der Komischen Oper mit beweglichem, exotisch bestücktem Schlagwerk beeindruckend souverän, höchst expressiv und sogar transparent.
… Titus Engel leitet das Riesenorchester der Komischen Oper mit beweglichem, exotisch bestücktem Schlagwerk beeindruckend souverän, höchst expressiv und sogar transparent.
Komische Oper im Flughafen Tempelhof: Requiem für die Verdammten des Wassers
Isabel Herzfeld, Der Tagesspiegel
Isabel Herzfeld, Der Tagesspiegel
#KOBMEdusa
16. September 2023
Den Toten eine Stimme geben
Anders, als es sich vermuten lässt, erzählt Das Floß der Medusa keinen Mythos. Das Oratorium von Hans Werner Henze taucht ein in die Geschichte der Kämpfe um Kolonien und ihrer Opfer zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Uraufführung des opulenten Werks Neuer Musik ging allerdings in Tumulten unter und musste abgebrochen werden. Warum das Oratorium 1968 ein Skandal war, was Dante damit zu tun und welche Rolle ein Gemälde spielt – das Wichtigste in Kürze...
#KOBMedusa
Oratorium
Einführung