© Iko Freese / drama-berlin.de
Der lange Weg zum Welterfolg
oder: am Anfang war das Wort
Jahrzehntelang galt George Bernard Shaws berühmteste Erzählung Pygmalion (1912) als unverfilmbar und untauglich für die New Yorker Broadway-Bühnen. Doch 1956 wagten Alan J. Lerner und Frederick Loewe das Unmögliche, auch weil plötzlich in der damaligen Musicalbranche nichts mehr unmöglich schien: Shaws Geschichte über einen exzentrischen Sprachwissenschaftler und seinem Experiment, den Weg zum sozialen Aufstieg allein durch kultiviertes Sprechen zu ebnen, machten My fair Lady zum (Musical)Welterfolg. Kurz nach der Premiere waren die Aufführungen für zwei Jahre ausverkauft, in den ersten fünf Jahren wird die Geschichte um den verschrobenen Sprachprofessor Henry Higgins mehr als zweitausend mal auf New Yorks Bühnen gespielt. Der Erfolg machte selbst vorm Eisernen Vorhang nicht halt: Als erste US-amerikanisches Musical wurde es in Moskau gezeigt, mitten im Kalten Krieg. Eine Einführung über steinige Wege, der Nähe Shaws zu seiner Figur Henry Higgins und Realismus auf der Musicalbühne.
von Johanna Wall
von Johanna Wall
New York City, Frühjahr 1956: Vor dem Marc Hellinger Theatre ist der Teufel los. Menschen drängen sich um den Theatereingang, haben zum Teil ihre Nachtlager auf dem Bürgersteig aufgeschlagen oder treten ungeduldig von einem Fuß auf den anderen. Ein nicht mehr ganz junger Herr schlängelt sich durch die Reihen, verteilt kostenlos Kaffee. Dass er wirklich der ist, der er vorgibt zu sein, glaubt ihm keiner: »Wenn Sie der Komponist sind, bin ich der König von Dänemark!« Aber es ist tatsächlich Frederick Loewe. Gemeinsam mit Alan J. Lerner konnte er wenige Tage zuvor die Premiere von My Fair Lady feiern – der Anlass für den ganzen Trubel. Die Karten sind innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft – für die nächsten zwei Jahre! Die Menschen in der Schlange müssen sich also noch etwas gedulden. My Fair Lady ist seit seiner Premiere am 15. März 1956 ein Sensationserfolg, gleichermaßen umjubelt von Presse wie Publikum. In den nächsten sechs Jahren wird es allein auf dem Broadway 2.717-mal aufgeführt und damit die erfolgreichste Produktion der Ära. Das Musical wird mit dem Tony Award ausgezeichnet, die Schallplattenaufnahme steht für zwei Jahre an der Spitze der Charts.
My Fair Lady
Frederick Loewe
Musical in zwei Akten [1956] nach George Bernard Shaws Pygmalion und dem Film von Gabriel Pascal
Buch von Alan Jay Lerner
Deutsch von Robert Gilbert
Buch von Alan Jay Lerner
Deutsch von Robert Gilbert
Die deutsche Erstaufführung findet 1961 am Berliner Theater des Westens unter anderem mit Karin Hübner, Paul Hubschmidt und Rex Gildo in den Hauptrollen statt. Die Übersetzung besorgt Robert Gilbert, der schon für Ralph Benatzkys Im Weißen Rößl und zahlreiche Filmschlager von Werner Richard Heymann (»Liebling, mein Herz lässt dich grüßen«, »Das gibt’s nur einmal« u. a. ) die Texte geschrieben hatte. Auch Hanns Eislers »Stempellied« stammt aus seiner Feder. Nachdem er auf Grund seiner jüdischen Herkunft während des Zweiten Weltkriegs in die USA emigrieren musste, konnte er nach seiner Rückkehr mit My Fair Lady endlich wieder an die Vorkriegserfolge anknüpfen. Frederick Loewe – den Mann mit dem Kaffee – kannte er noch als Friedrich Löwe. In Kindertagen hatten sie in Berlin gemeinsam im Sandkasten gebuddelt. My Fair Lady wurde in weitere zehn Sprachen übersetzt und so zu einem internationalen Kassenschlager. Plácido Domingo spielte in der spanischsprachigen Erstaufführung in Mexico City einen von Doolittles Kumpanen. 1964 erfolgte in Moskau mitten im Kalten Krieg die erste russischsprachige Aufführung eines amerikanischen Musicals jenseits des Eisernen Vorhangs. Doch so steil der Aufstieg des Jahrhundert-Musicals auch war, der Weg dorthin war ähnlich lang und beschwerlich wie der zum Kartenschalter des Marc Hellinger Theatres am 16. März 1956 …
Eine ungewöhnliche Romanze
Ziemlich genau 44 Jahre vor der Uraufführung von My Fair Lady, im März 1912 machte sich der spätere Nobelpreisträger George Bernard Shaw an die Arbeit zu seiner bis heute beliebtesten und bekanntesten Komödie: Pygmalion. »Es ist die Geschichte eines armen Mädchens, das am Portal einer Kirche einem Gentleman begegnet und von ihm in eine wunderschöne Dame verwandelt wird. Das nenne ich Romanze.« Im engeren Sinne »romantisch« geht es in der Geschichte über den egozentrisch-skurrilen Sprachforscher Henry Higgins, der durch brachiales Sprachtraining die raubeinige Blumenhändlerin Eliza Doolittle zu einer Dame der höheren Gesellschaft zurechtstutzt, allerdings nicht zu.
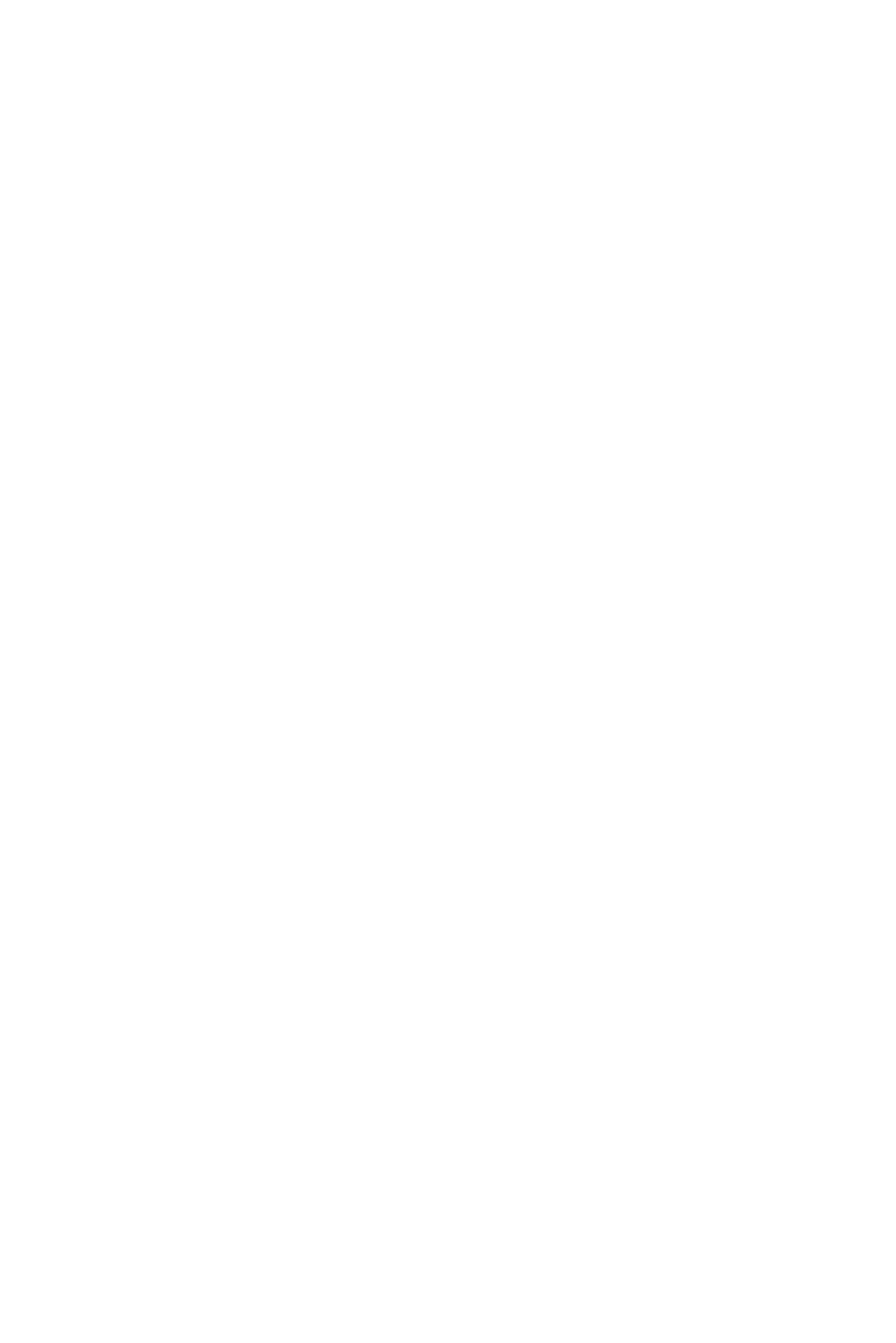
© Iko Freese / drama-berlin.de
Wie schon am Titel ablesbar, bezieht sich Shaw in seinem Werk auf antike Vorbilder, nämlich den Mythos des Pygmalion, wie er um die Zeitenwende von Publius Ovidius Naso in Verse gefasst wurde. Bei Ovid verbirgt sich hinter dem Namen Pygmalion ein Bildhauer, der sich – der Frauenwelt überdrüssig – nur mehr der eigenen Arbeit widmet und in eine von ihm selbst geschaffene Statue verliebt. Wie schon der sagenhafte Künstler versucht auch Henry Higgins, Eliza nach seinen spezifischen Vorstellungen zu einem weiblichen Idealbild zu formen, wenngleich es bei Shaw dabei nicht unbedingt um Liebe geht.
Elise oder Eliza?
Neben der antiken Vorlage mögen auch andere literarische und historische Quellen Shaw als Inspiration gedient haben. So behandelt die Erzählung Regine von Gottfried Keller den authentischen Fall des Schweizer Kinder- und Nähmädchens Elise (!) Egloff, die Mitte des 19. Jahrhunderts als unstandesgemäße Braut ihres Verlobten, des Heidelberger Professors Jacob Henle, in einem wohldokumentierten Experiment durch ihn und seine Familie mit Hilfe systematischer Bildung zu einer Dame der besseren Gesellschaft geformt werden sollte. Das größte Problem dabei war laut Henles Schwester, dass es Elise schlicht unmöglich war, untätig herumzusitzen, wie es sich für eine Frau des Bildungsbürgertums zur damaligen Zeit geziemte. Shaw, der gute Deutschkenntnisse besaß, kannte mit großer Wahrscheinlichkeit Gottfried Kellers Werk, das um die vorvergangene Jahrhundertwende im englischsprachigen Raum zum Teil höher eingeschätzt wurde als die Schriften Goethes.

© Iko Freese / drama-berlin.de
Ein aus Shaws Perspektive noch aktuellerer Vorfall hat wohl direkten Niederschlag in seinem Pygmalion gefunden. Es ist der Fall der 13-jährigen Eliza Armstrong, die, wie die Eliza Doolittle des Dramas, im Londoner Stadtteil Lisson Grove geboren wurde. 1885 wurde das Mädchen von ihrer Mutter, einer Alkoholikerin, für 5 £ (nach heutiger Währung ca. 530 €) an einen Bordellbesitzer verkauft. Eingefädelt hatte den Handel der Journalist W. T. Stread, der damit eine beispiellose Kampagne gegen die im Vereinigten Königreich grassierende Kinderprostitution initiierte, die als »The Maiden tribute of modern Babylon« in die Geschichtsbücher einging. Stread erwirkte so immerhin die Anhebung des heiratsfähigen Alters bei Mädchen von 13 auf 15 Jahre. Der Ruf des Stadtteils Lisson Grove aber war dermaßen ruiniert, dass die Straße, in der Eliza gelebt hatte, umbenannt wurde.
Der echte ’enry ’iggins
Ob sich hinter dem »wahren« Henry Higgins tatsächlich Shaw selbst verbirgt, wie immer wieder zu lesen ist, sei dahingestellt. Gesichert ist allerdings Shaws intensives Verhältnis zur Wunschbesetzung der Uraufführungs-Eliza: Stella Patrick Campbell. Sie galt vielen als »Geschöpf« des Dramatikers. Mit der Schauspielerin verband ihn eine 15-jährige zum Teil leidenschaftliche Beziehung, aus der er sich jedoch – angeblich zugunsten seiner Arbeit – schließlich zurückzog. Auch der Gesangslehrer von Shaws Mutter, John Vandaleur Lee, wurde zu Zeiten als Vorbild für Henry Higgins, wenn nicht sogar als leiblicher Vater des Dramatikers gehandelt. Shaw nennt im Vorwort des Stücks allerdings einen anderen Namen: Henry Sweet. Sweet galt als ebenso misanthropischer wie genialer Phonetiker und verfasste Ende des 19. Jahrhunderts eine eigene Lautschrift, die sich allerdings – angeblich aufgrund akademischer Ränkespiele und des exzentrischen Benehmens Sweets – nicht durchsetzen konnte. Sweet gilt als Genius, selbst wenn er es nie zu der von ihm angestrebten Professur in Oxford brachte.
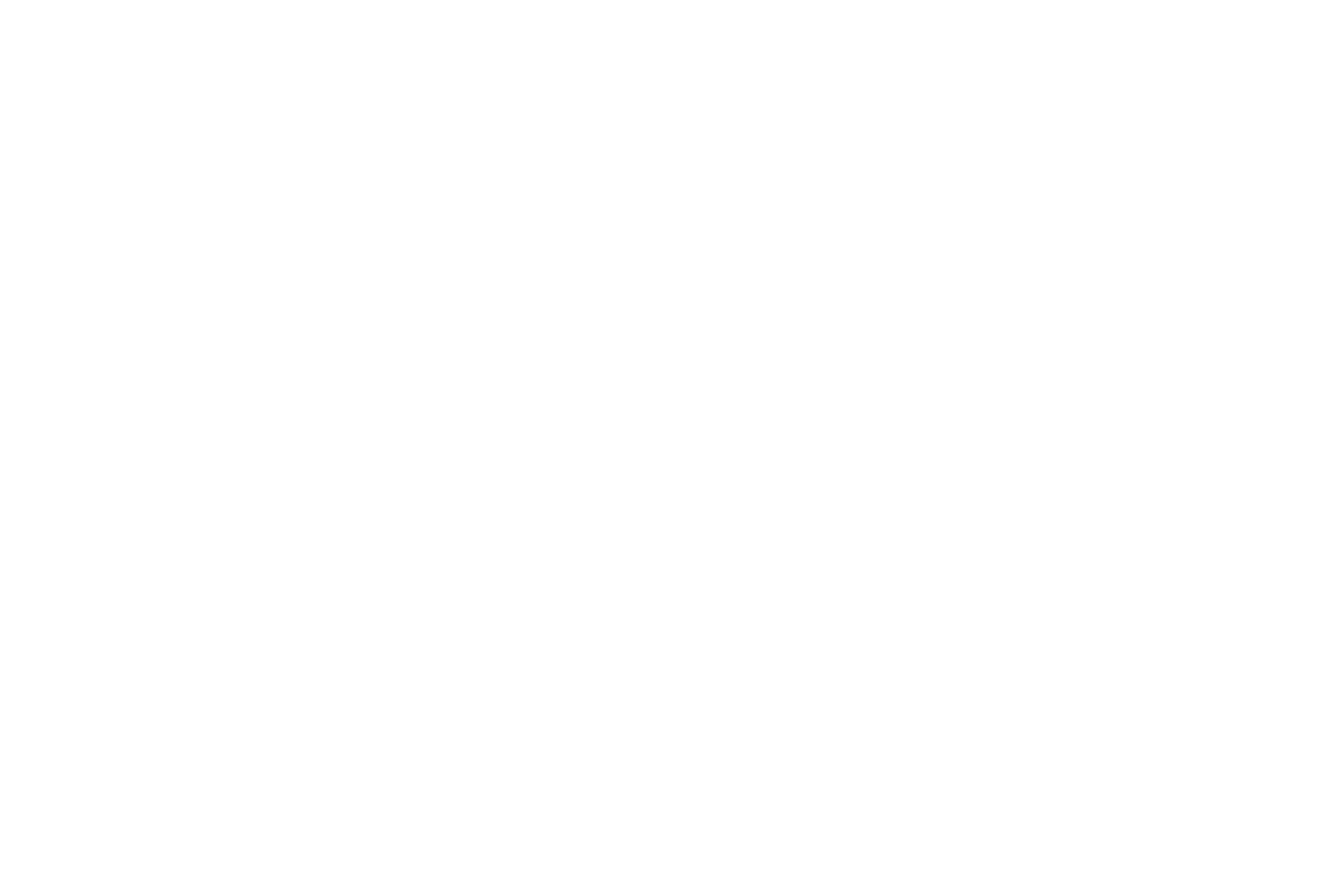
© Iko Freese / drama-berlin.de
Leute, lernt sprechen!
George Bernard Shaw war sich durchaus bewusst, dass ein Stück mit einem Phonetik-Professor als männliche Hauptrolle nicht gerade der Stoff für einen Publikumshit ist. Jenseits der Tatsache, dass das Werk wider Erwarten äußerst positiv aufgenommen wurde, schien dies dem Autor allerdings herzlich egal zu sein: »Das Stück ist so nachdrücklich und offensichtlich didaktisch, und sein Sujet gilt als so trocken, dass es mir eine Freude ist, es all jenen Schlaubergern an den Kopf zu knallen, die wie die Papageien ständig wiederholen, dass Kunst nie didaktisch sein sollte. Ich halte mit meiner Behauptung dagegen, Kunst sollte nie etwas anderes sein!« Als 20-Jähriger war Shaw aus Irland nach England übersiedelt und hatte am eigenen Leibe zu spüren bekommen, welche Türen dem verschlossen bleiben, der sich nicht im Idiom der höheren britischen Schichten auszudrücken weiß. Einen Großteil seines Privatvermögens vermachte er einem Projekt zur Reform der englischen Sprache, regte höchst persönlich die Schaffung eines neuen phonetischen Alphabets an und war Vorsitzender im Beratungskomitee »On Spoken English« des BBC. Sein wichtigstes Ansinnen in Pygmalion war nach eigenem Bekunden, »die Menschen darüber aufzuklären, dass es so etwas wie Phonetiker überhaupt gibt« und dass sie zu den »wichtigsten Menschen im heutigen England« gehörten. Ihm ging es darum, »all jene bedauernswerten Menschen zu ermutigen, denen aufgrund ihres Akzents berufliche Aufstiegschancen verwehrt blieben«. Als Realist forderte er allerdings weniger die Auflösung der sozialen Hierarchien als vielmehr deren Durchlässigkeit. Dies bezieht sich jedoch nur auf jene, die diesen mühevollen Weg überhaupt anstrebten. Prinzipiell ist der sogenannte »soziale Aufstieg« bei Shaw gar nicht uneingeschränkt positiv gewertet. Für Elizas Vater, Alfred P. Doolittle, bedeutet er keine Befreiung, sondern eine Nötigung. Shaws etwas widersprüchlich wirkender Ausspruch – »lieber ein ehrlicher und natürlicher Slum-Dialekt als die nachgemachte vulgäre Ausdrucksweise der Golfclubs!« – klingt vor diesem Hintergrund weit weniger snobistisch und lässt den Ästheten hinter dem Gesellschaftskritiker erkennen. Bis heute sind die Grenzen zwischen einzelnen sozialen Klassen im Vereinigten Königreich schärfer gezogen und zeichnen sich prägnanter in der Sprache ab als in vielen anderen europäischen Sprachen – das Deutsche mit eingeschlossen, wobei das Berlinische hierbei eine gewisse Ausnahme bilden mag.
Erster Anlauf – vergebliche Liebesmüh
Die Uraufführung von Pygmalion erfolgte, trotz des spezifisch englischen Sujets, 1913 in deutscher Sprache am Hofburgtheater in Wien. Die Erstveröffentlichung im Druck erschien im selben Jahr ebenfalls in deutscher Übersetzung. Es verwundert deshalb nicht, dass sich gerade Franz Lehár 1921 als Erster um die Rechte für eine Operettenversion des Erfolgsstücks bemühte. Shaw ließ bei seiner Antwort an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: »Ich verbitte mir solche Vergewaltigungen!«
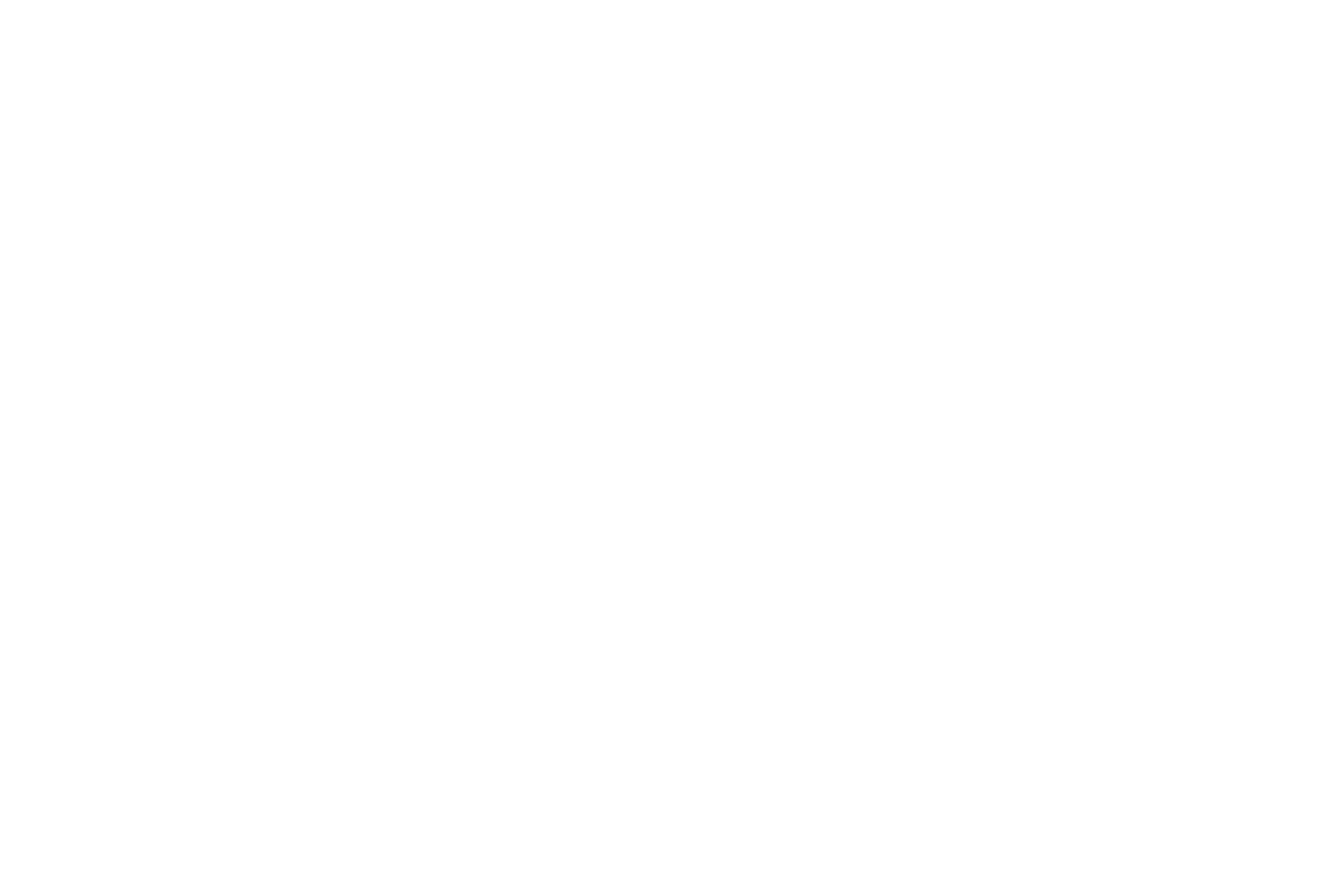
© Iko Freese / drama-berlin.de
Der ungarische Produzent Gabriel Pascal konnte in den 1930er Jahren dennoch die Filmrechte von Shaw erwerben. 1935 drehte Erich Engel den Streifen Pygmalion mit Jenny Jugo und Gustav Gründgens in den Hauptrollen, eine britische Verfilmung folgte drei Jahre später. Am preisgekrönten Drehbuch zu Letzterer arbeitete sogar Shaw selbst mit und fügte unter anderem die Ballszene in der Botschaft ein, die sich auch im Musical wiederfindet. Pascal versuchte, den Stoff auch in den USA an den Mann, besonders aber, an den Broadway zu bringen. Doch dies erwies sich, nicht nur wegen des Verdikts des inzwischen verstorbenen Shaw, als äußerst schwierig. Das Stück, im Textbuch als »Romanze« bezeichnet, war zwar ein Publikumsrenner. Aber das »Unhappy Ending« und die Tatsache, dass keine Liebesgeschichte im Zentrum steht und darüber hinaus ein weiterer Handlungsstrang mit einem musicaltypischen buffonesken zweiten Liebespaar fehlt, war lange Zeit Grund genug, dass sich niemand am Broadway für eine Bearbeitung interessierte. Gleich eine ganze Riege renommierter Künstler winkte ab, unter ihnen Rodgers & Hammerstein II, Cole Porter und Noël Coward. 1952, über 20 Jahre nachdem Pascal die Rechte erworben hatte, bot er den »Ladenhüter« schließlich dem Musical-Texter Alan J. Lerner an – doch auch der schlug das Angebot zunächst aus.
Lerner und Loewe – Das gemischte Doppel
Ein Jahr zuvor hatten Lerner und sein Komponist Frederick Loewe mit Paint Your Wagon einen großen Erfolg am Broadway gefeiert.Lerner war der Sohn eines wohlhabenden Textilunternehmers und wuchs in einem Apartment in der mondänen Park Avenue auf. Eigentlich sollte der Harvard-Absolvent und Klassenkamerad John F. Kennedys geschäftlich in die Fußstapfen des Vaters treten, setzte sich aber schließlich mit seinem Wunsch durch, ans Theater zu gehen. Er war bekannt als Gentleman und für seinen außergewöhnlichen Sinn für Humor, aber auch dafür, achtmal verheiratet und zeitweilig medikamentensüchtig gewesen zu sein. Besonders aber litt er Zeit seines Lebens beruflich an massiven Versagensängsten. Der 15 Jahre ältere Loewe war aus anderem Holz geschnitzt. Geboren im Jahre 1901 unter dem Namen Friedrich Löwe als Sohn österreichischer Eltern in Berlin, wurde sein musikalisches Talent früh entdeckt. Eine Klasse unter dem weltberühmten chilenischen Pianisten Claudio Arrau studierte er am renommierten Stern’schen Conservatorium Klavier und trat bereits als 20-Jähriger solistisch auf. Mit seinem Vater, einem international gefragten Operettentenor, verließ er Mitte der 1920er Jahre Berlin und versuchte in den USA sein Glück, was sich als kompliziert herausstellte. Zunächst verdiente er sein Geld als Stummfilmpianist, während der wirtschaftlichen Depression versuchte er sich aber auch als berittener Postmann im ländlichen Montana und schlug sich als Preisboxer durch. Sein späteres Motto lautete: »Ich bin zu alt, um bescheiden zu sein.«
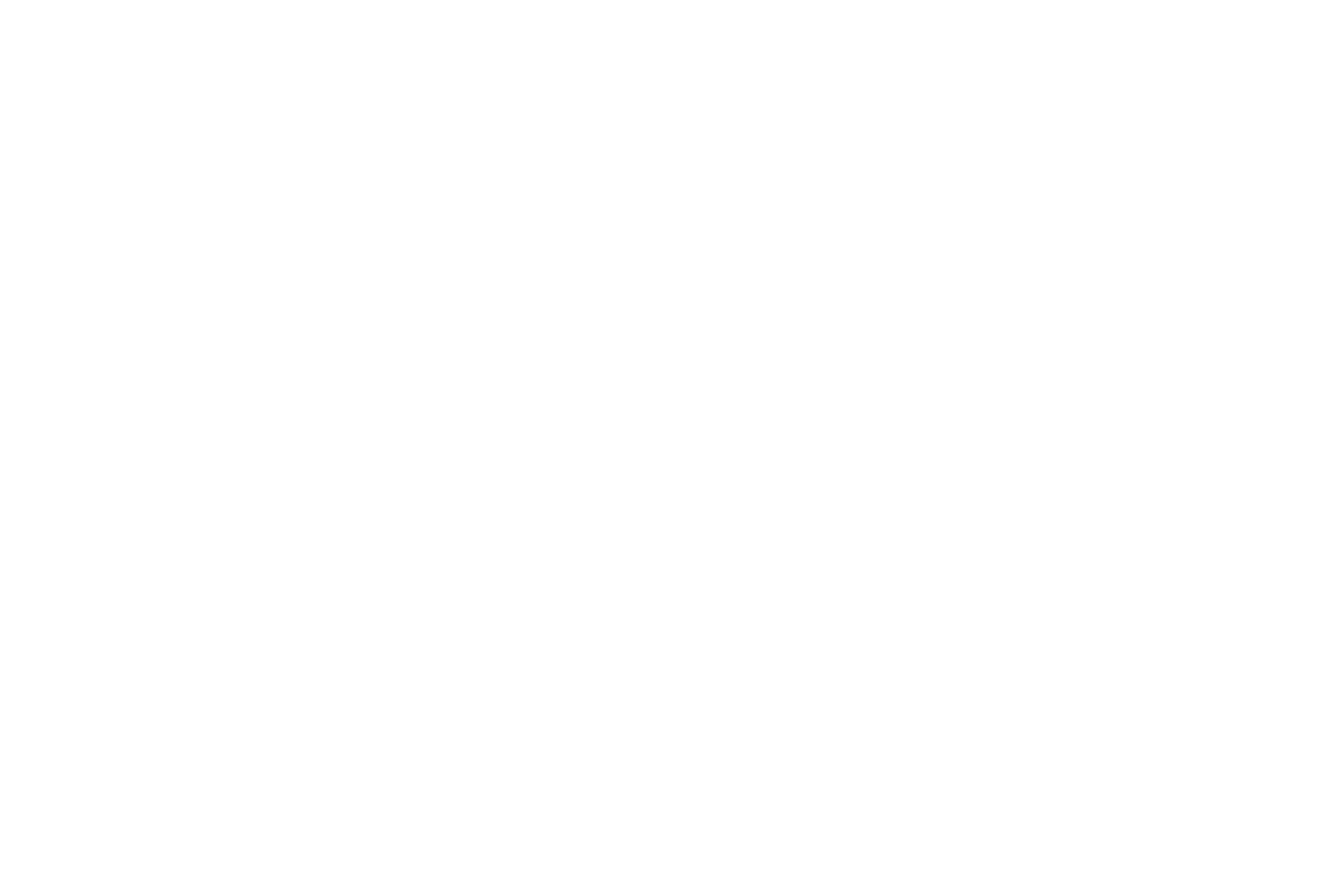
© Iko Freese / drama-berlin.de
Erstmals kennengelernt hatten sich Lerner und Loewe Anfang der 1940er Jahre in einem angesagten New Yorker Club. Nach einigen Anläufen hatten sie 1947 mit Brigadoon einen ersten großen Erfolg verbuchen können. 1952 galten sie als eingespieltes Team. Für ein Vierteljahrhundert bildeten Lerner und Loewe eines der produktivsten Künstlergespanne des Broadway. Ihre Arbeitsweise beschrieb Lerner als äußerst pragmatisch: »Zuerst entschieden wir, wo im Stück ein Song gebraucht wurde. Dann: Worum soll die Nummer gehen? Drittens: Welche Stimmung soll der Song haben? Viertens: Ich gab Loewe einen Titel. Dann schrieb er die Musik, und das generelle ›Gefühl‹ des Songs wurde festgelegt. Und wenn er die Musik fertig hatte, schrieb ich die Verse.« Die künstlerische Einzigartigkeit des Duos aber beschreibt ein Biograf: »Lerners Texte sind wie geschliffen Glas. Loewe denkt Musik in Farben.«
Zweiter Anlauf – Die Nuss ist geknackt!
Zwei Jahre nachdem Lerner den Pygmalion-Stoff erstmals abgelehnt hatte, hatten sich die Zeichen in der Musicalbranche gewendet. Lerner selbst wunderte sich: »Unüberwindbare Probleme wurden nicht gelöst, sie lösten sich einfach von selbst.« Über seinen Anwalt – Pascal war inzwischen verstorben – erwarb Lerner bei Shaws Erben die Verwertungsrechte von Pygmalion. Plötzlich war es für ein Broadway-Musical, das bis dato besonders Wert auf eine starr festgelegte Dramaturgie, eine ausgewogene Anzahl von Einzel- und Ensemblenummern und ein großes Showfinale gelegt hatte, kein Tabu mehr, sieben von sechzehn Songs als Monologe zu gestalten und im gesamten Stück nur zwei große Tanznummern – sogenannte »production numbers« – einzubauen. Nach der Pause wurde überhaupt nur noch einmal getanzt und das nicht einmal im Finale. Was das Singen anging, sah es nicht viel anders aus: Die Rolle des Henry Higgins wurde an die Fähigkeiten des musikalisch vollkommen unbeleckten Rex Harrison – eine Empfehlung Noël Cowards, der seinerseits die Rolle abgelehnt hatte – angepasst. Dass der Schauspieler halbwegs im Rhythmus sprechen konnte, genügte dem Komponisten. Während Shaw seine Figuren ganz durch ihren jeweiligen Jargon definierte und sein Stück »mit der ihm eigenen Sprachmusik« für gut befand, verlieh Loewe den Charakteren durch ihr spezifisches musikalisches Idiom eine zusätzliche Ebene. Die vermeintliche Not des Higgins-Darstellers wurde zur Tugend, indem der sprachversessene Higgins bei Loewe eine für die Figur treffende, gänzlich unsinnlich trockene Sprachmelodie erhielt. Typisch zu hören ist das in seiner ersten Nummer, dem über weite Teile in dozierendem Sprechgesang gehaltenen »Kann denn die Kinder keiner lehren, wie man spricht?«. Eliza hingegen ist zwar in ihren gesprochenen Dialogen nicht auf den Mund gefallen, verrät aber schon durch den sanglich-lyrischen Tonfall ihrer ersten Nummer »Wäre das nicht wundaschön« viel über ihre emotionale Kraft. Elizas große Gefühlstiefe – oder besser -höhe? – spiegelt sich auch in ihrer großen stimmlichen Bandbreite, zum Beispiel im gesangstechnisch anspruchsvollen »Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht«. Higgins darf – oder muss? – sich erst ganz am Ende auf das gefährliche Terrain der Gefühle und des melodiösen Gesangs wagen, nämlich genau dann, wenn er entdeckt, wie sehr ihm Eliza ans Herz gewachsen ist und er verwundert feststellt: »Ich bin gewöhnt an ihr Gesicht.« Eliza ist als seine gelehrige Schülerin zu diesem Zeitpunkt an einem gänzlich anderen Punkt angelangt: Wie weit es der Sprachfetischist Higgins mit seinen Erziehungsversuchen bei ihr gebracht hat, zeigt sich nicht zuletzt im Song »Tu’s doch«, in dem sie den armen Freddy – dem im Übrigen die einzige Arie des Stücks vergönnt ist – mit rhetorischer Raffinesse vollends aus dem Konzept bringt. Auch an anderer Stelle gelingt es Loewe, Shaws Text in musikalisch sinnfällige Formen zu fassen. So in der feurig-rhythmischen und thematisch stimmigen Sprechübungs-Habanera »Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen« oder in der großen, an die klassische Wiener Operette – und damit zu Zeiten des aufkommenden Rock ’n’ Roll an überkommene Konventionen – gemahnende Walzernummer beim Botschaftsball.
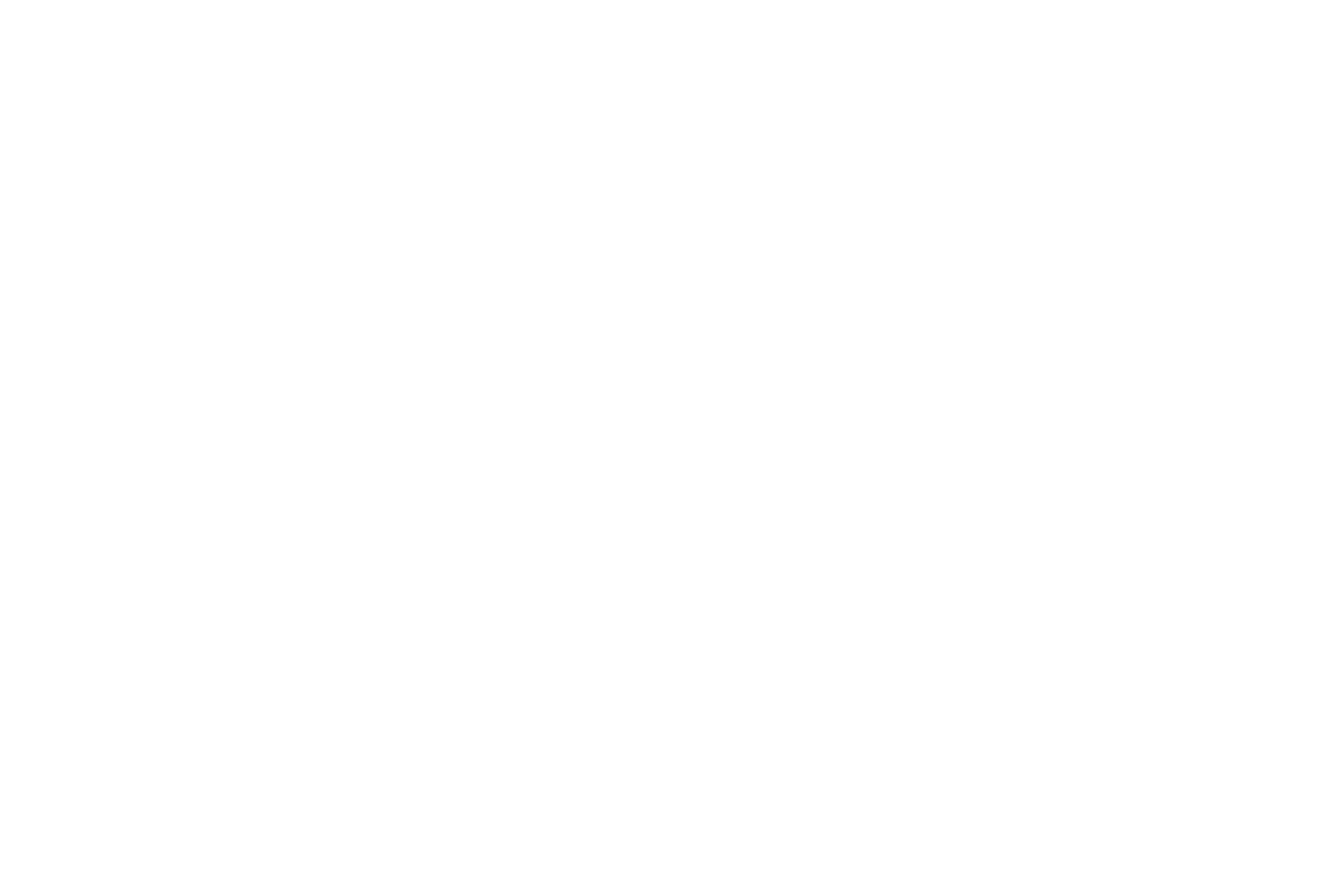
© Iko Freese / drama-berlin.de
Lerner hielt sich in seiner textlichen Umsetzung erstaunlich nah an Shaws Vorlage, wenngleich sein Schluss zumindest die Möglichkeit eines glücklichen Endes für Eliza und Higgins zulässt – Shaw hatte sein Stück noch 1939 extra umgeschrieben, um derartigen Deutungsansätzen einen Riegel vorzuschieben. Anders als bei Shaw erfahren die Charaktere – insbesondere der der Eliza – eine gewisse Entwicklung innerhalb des Stücks. Eliza, die sich, alles andere als blauäugig, selbst für ihr Sprachstudium bei Higgins entschlossen hat, merkt zwar am Ende, dass sie nicht nur eine Kompetenz gewonnen, sondern auch eine Heimat – und ein Stück ihrer Selbst – verloren hat, doch lässt sie in ihrem pragmatischen Do-it-yourself-Gestus auch als Lady die besten Seiten ihres alten Ichs durchblitzen. Der Hyperrationalist Higgins hingegen entdeckt schließlich doch noch seine weiche Seite. Es ist einer der anrührendsten – und inszenatorisch schwierigsten – Momente des Stücks, wenn er vor der plötzlich aufgetauchten Eliza nach den rechten Worten ringt und seine bisher chauvinistische Frage nach den Pantoffeln ganz und gar deplatziert wirkt. Lerner mag hier weniger realistisch sein als Shaw, aber darin sah er keinen Makel: »Sie müssen im Kopf behalten, dass es so etwas wie Realismus oder Naturalismus im Theater nicht gibt. Das ist ein Mythos. Gäbe es im Theater Realismus, gäbe es nie einen dritten Akt. Nichts endet so. Das menschliche Leben ist ein Stückwerk aus tausenden und abertausenden von kleinen Stücken. Wer einen Roman schreibt, sucht sich zwanzig oder dreißig davon aus. Für ein Musical sogar noch viel weniger.«
KOBMyFairLady
10. März 2025
Von der Herrschaft der Sprache zur Macht der Musik
Wie überträgt man den britischen Dialekt von My fair Lady ins Deutsche? Andreas Homoki findet die Antwort im Berlinischen, das wie das Cockney des Londoner East End soziale Grenzen markiert. Seine Inszenierung zeigt, dass Sprache nicht nur verbindet, sondern auch ausschließt – und wie sich soziale Aufstiege und Machtverhältnisse allein durch die richtigen Worte formen. My fair Lady macht aus diesem Klassenkampf ums 'richtige Sprechen' eine heitere Persiflage. Überzeichnet stellt Andreas Homokis Inszenierung die Frage: Lässt sich der Klassenkampf mit dem richtigem Sprachgefühl beenden? Ein Gespräch über die subtile Gewalt der Sprache, über Dialekt als soziales Stigma und darüber, warum der feine Stil der Oberschicht nichts wert ist, wenn man ihn mit den „falschen“ Worten trägt.
#KOBMyFairLady
Interview


