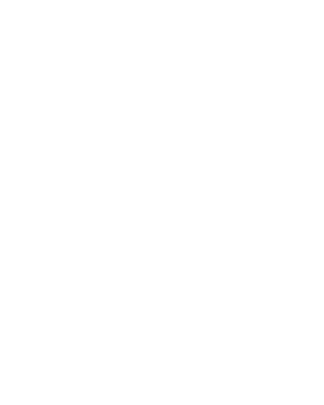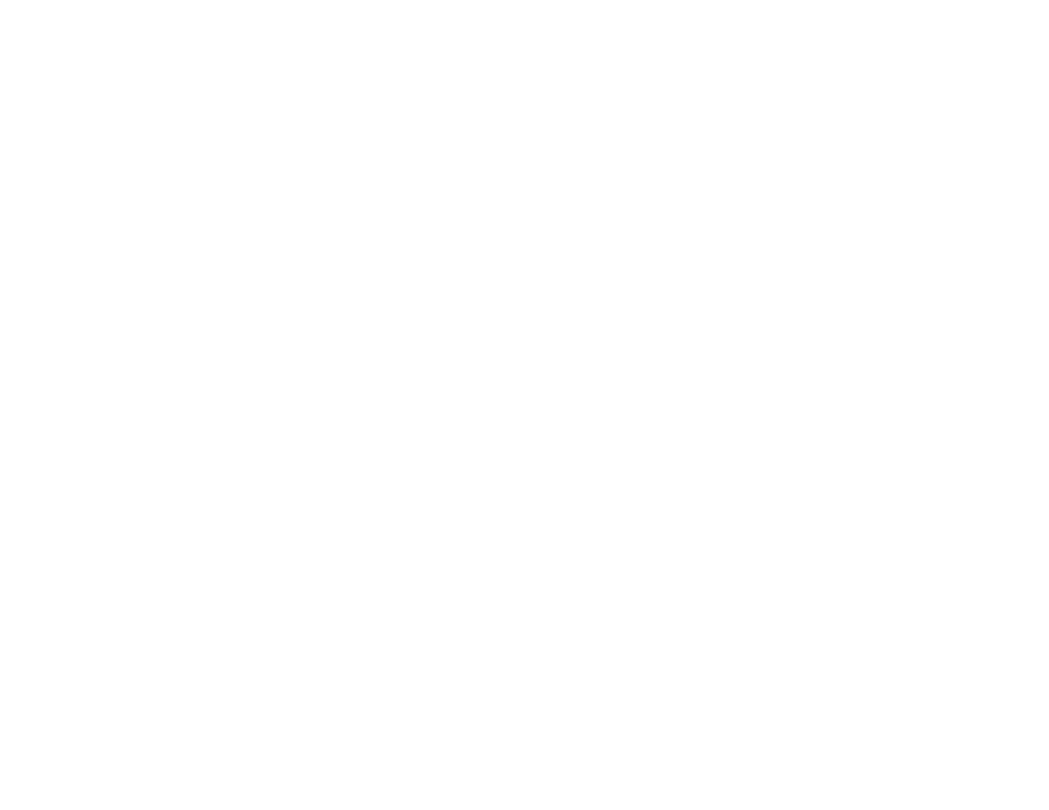© Monika Rittershaus
Die Kunst der Pornophonie
Über stoßende, keuchende und stöhnende Musik in Dmitri Schostakowitschs Lady Macbeth von Mzensk
von Daniel Andrés Eberhard
von Daniel Andrés Eberhard
Mord und Totschlag, Gewaltexzesse und Misshandlungen, Besäufnisse und Prügeleien – all das hat man in der Oper seit jeher zu Genüge gesehen. Doch bei einem ganz bestimmten Thema tat man sich schon immer etwas schwerer: Sex. Obwohl zwar unzählige Opernstoffe um die schönste Nebensache der Welt kreisen, fällt doch auf, dass auf den Bühnen dieser Welt ein kaltblütiger Mord bis heute leichter von der Hand geht als eine intime Erotikszene. Fingerspitzengefühl war demnach schon immer gefragt: Mozart arbeitete noch vergleichsweise subtil, Wagner wurde zumindest musikalisch schon recht konkret. Doch selbst bei ihm fehlt bisweilen die letzte Konsequenz: Wenn das Geschwisterpaar Siegmund und Sieglinde am Ende des ersten Aktes der Walküre leidenschaftlich inzestuös übereinander herfällt und das Orchester das nun Folgende in aller Deutlichkeit herausposaunt, lautet die Szenenanweisung: »Der Vorhang fällt schnell« – sicher ist sicher!
Lady Macbeth von Mzensk
Oper in vier Akten [1934]
nach einer Erzählung von Nikolai S. Leskow
Libretto von Alexander G. Preis
Premiere am 31. Januar 2026
nach einer Erzählung von Nikolai S. Leskow
Libretto von Alexander G. Preis
Premiere am 31. Januar 2026
Was Wagner hier noch szenisch verbergen wollte, erleben wir in voller Pracht erst so richtig bei Dmitri Schostakowitsch. Die extreme Tabulosigkeit, mit der er die Triebhaftigkeit des Menschen in seiner Oper Lady Macbeth von Mzensk offenlegte, ist auch über 90 Jahre nach der Entstehung des Werkes beispiellos. »Schostakowitsch ist der ranghöchste Komponist pornographischer Musik in der Geschichte der Kunst«, urteilte ein Kritiker in der New York Times, nachdem das Werk 1935 seine ersten erfolgreichen Aufführungen in den USA feierte. Ein Kritiker der New York Sun erfand gar einen neuen Gattungsbegriff: Pornophonie!
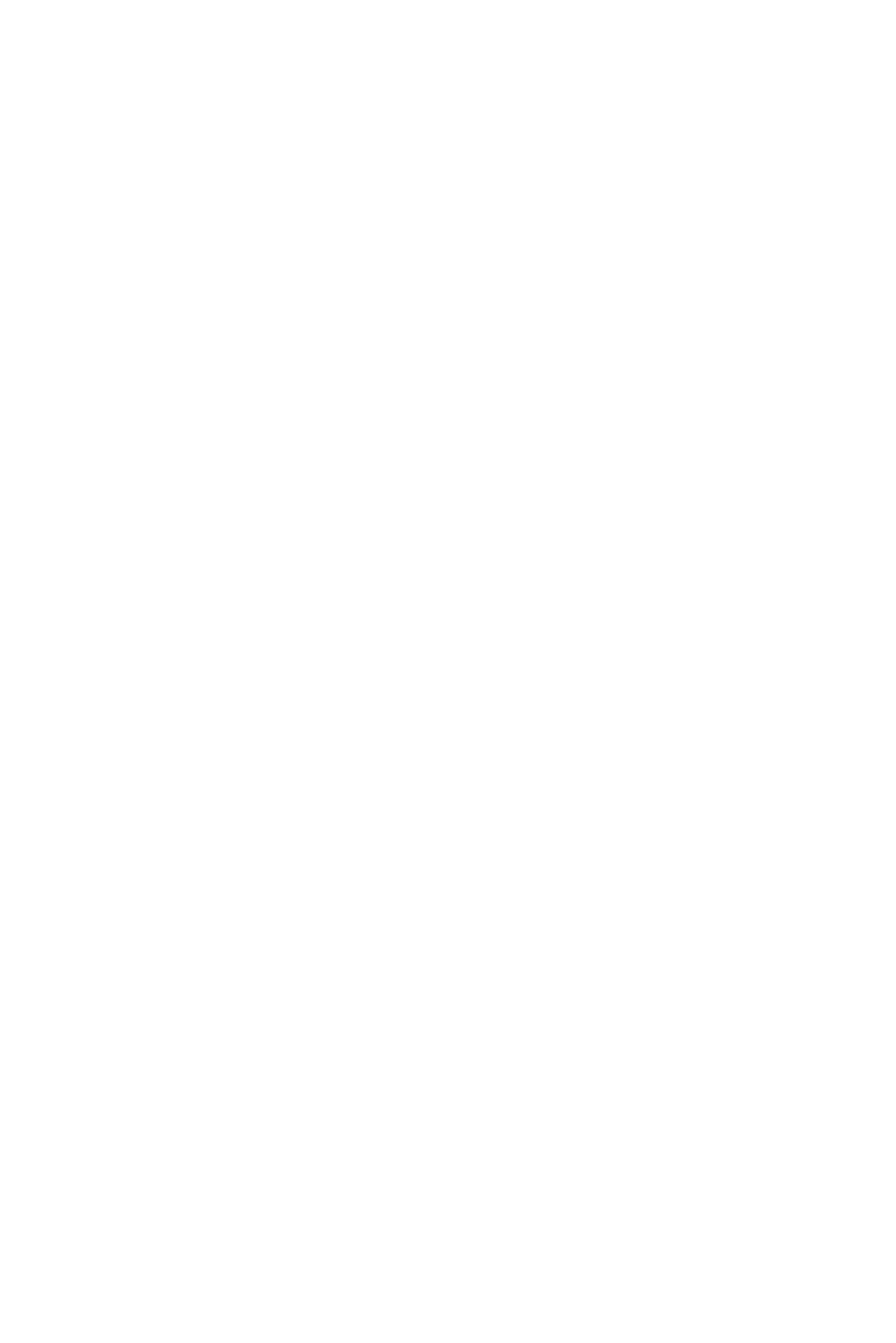
© Monika Rittershaus
Chaos statt Musik
In Russland wurde das Werk zu dieser Zeit noch frenetisch umjubelt, nachdem es 1934 als eine Art Doppelpremiere am 22. Januar in Leningrad (heute Sankt Petersburg) und nur zwei Tage später in Moskau zur Uraufführung kam. Ein Besuch Josef Stalins sorgte für das jähe Ende der Erfolgswelle:
Im vernichtenden Pamphlet »Chaos statt Musik«, das am 28. Januar 1936 in der Prawda ohne Autorangabe – und damit als Artikel der Redaktion höchstwahrscheinlich unter Anordnung Stalins – erschien, ging man mit der Oper gnadenlos ins Gericht. Von einem auf den anderen Tag wurde Schostakowitsch zur Persona non grata, stürzte in eine schwere Lebenskrise und rechnete in der nun anbrechenden Ära der stalinistischen Säuberungen täglich damit, verhaftet zu werden, wie so viele Kunstschaffende, die dem Regime ein Dorn im Auge waren. Der besagte Prawda-Artikel lässt erahnen, was Stalin an Lady Macbeth von Mzensk so gestört hatte:
Im vernichtenden Pamphlet »Chaos statt Musik«, das am 28. Januar 1936 in der Prawda ohne Autorangabe – und damit als Artikel der Redaktion höchstwahrscheinlich unter Anordnung Stalins – erschien, ging man mit der Oper gnadenlos ins Gericht. Von einem auf den anderen Tag wurde Schostakowitsch zur Persona non grata, stürzte in eine schwere Lebenskrise und rechnete in der nun anbrechenden Ära der stalinistischen Säuberungen täglich damit, verhaftet zu werden, wie so viele Kunstschaffende, die dem Regime ein Dorn im Auge waren. Der besagte Prawda-Artikel lässt erahnen, was Stalin an Lady Macbeth von Mzensk so gestört hatte:
»Das Publikum wird von Anfang an mit absichtlich disharmonischen, chaotischen Tönen überschüttet. Melodiefetzen und Ansätze von Musikphrasen erscheinen nur, um sogleich wieder unter Krachen, Knirschen und Gekreisch zu verschwinden. Dieser ›Musik‹ zu folgen ist schwer, sie sich einzuprägen unmöglich. [...] Alles ist grob, primitiv und trivial. Die Musik schnattert, stöhnt und keucht, um bei jeder sich bietenden Gelegenheit möglichst drastisch die Liebesszenen auszumalen; und diese ›Liebe‹ wird in der Oper auf ausgesprochen vulgäre Art ausgebreitet. Das Doppelbett des Kaufmanns steht als Mittelpunkt auf der Bühne. Auf diesem Bett werden alle ›Probleme‹ gelöst.«
Stalins Unmut überrascht aus heutiger Sicht wenig: Schostakowitschs satirische Kritik an der Staatsgewalt in der Polizeiszene des dritten Aktes oder auch die Finalszene im Arbeitslager, die vor dem Hintergrund des Ausbaus der Gulags in der Stalinzeit ungewollt provokativ geworden war – all das dürfte dem Despoten wenig gefallen haben. Und dennoch liegt der Fokus im Prawda-Artikel vor allem auf der »disharmonischen Musik« und – wie könnte es anders sein – auf der Darstellung der Sexszenen. In seinen postulierten Moralvorstellungen erwies sich Stalin bekanntlich als ausgesprochen prüde.
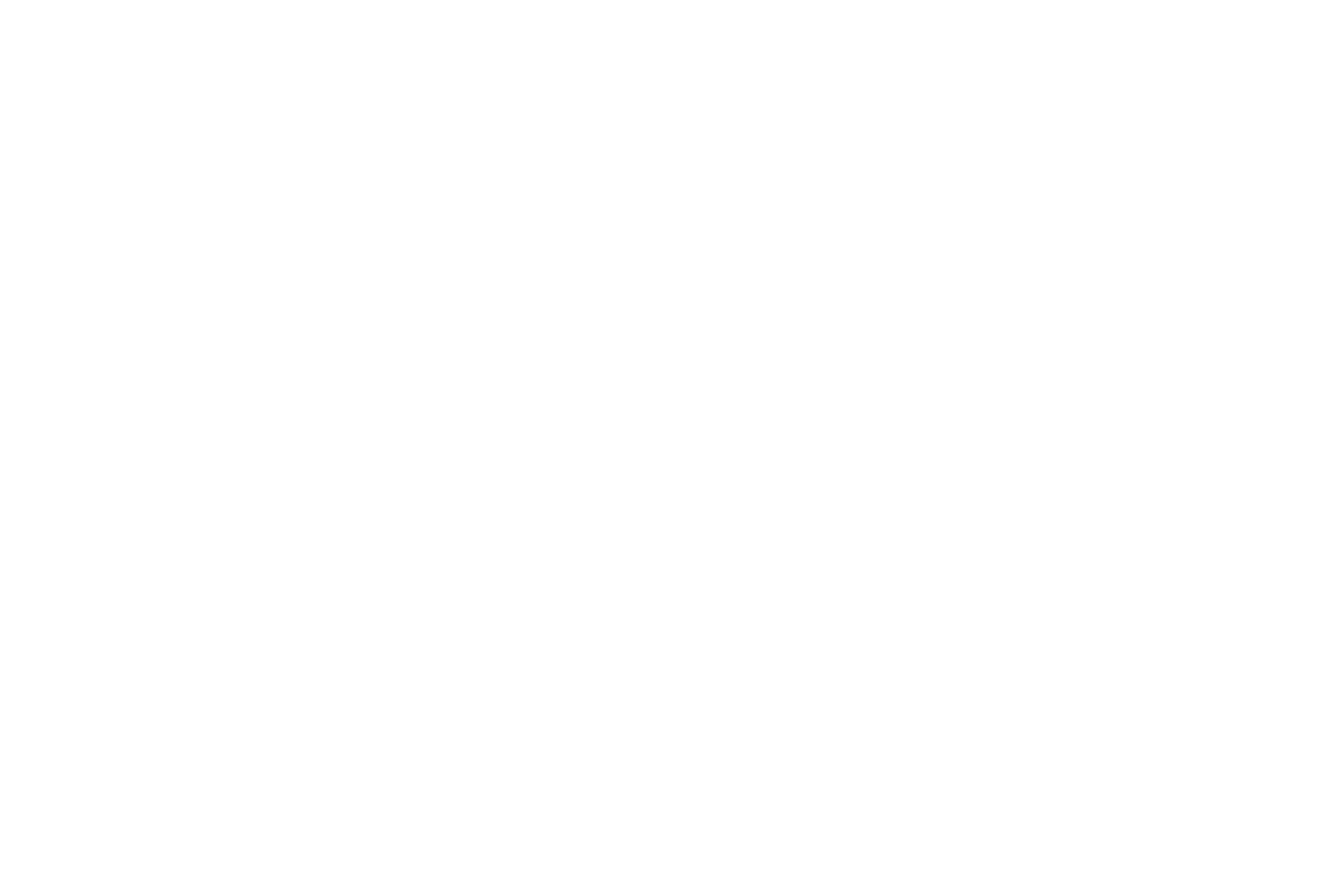
© Monika Rittershaus
Schluss mit der Verklemmtheit
Nachdem das Werk seit 1936 in Russland von allen Spielplänen verschwunden war, wagte Schostakowitsch erst nach Stalins Tod einen Neuanlauf mit seiner Lady Macbeth. Er änderte die vulgärsten sprachlichen Stellen, entschärfte zahlreiche musikalische Aggressionen, gab dem Werk nun den Titel Katerina Ismailowa, und selbstverständlich strich er auch die großangelegte Sexszene zwischen Katerina und Sergej im ersten Akt. Nach dem Tod des Komponisten war endlich wieder Schluss mit der Verklemmtheit. Unter dem Dirigat von Mstislaw Rostropowitsch wurde die radikalere »Urfassung« 1979 wieder veröffentlicht und hat sich seitdem allgemein etabliert. In unseren heutigen aufgeklärten Zeiten dürfen wir den Bühnen-Porno somit wieder voll auskosten. Kunst und Porno – lange Zeit galt das eigentlich als unvereinbar. Schostakowitsch zeigt in seiner Lady Macbeth, wie es gehen kann. Der Hang zum Obszönen und Vulgären wirkt zwar bis heute provokativ, verfolgt in diesem Stück aber ein klares Ziel. Denn in den so unverblümt ausgestellten Sexszenen geht es vor allem darum, die menschliche Psyche offenzulegen – von ihrer wohlgemerkt schlechtesten Seite. Im dritten Bild des ersten Aktes wird Sex beispielsweise als etwas rein Animalisch-Triebhaftes dargestellt, dem jegliches Gefühl von wirklicher Liebe abhandengekommen ist: In halsbrecherischem Tempo stößt und stampft die Musik, die Posaunenglissandi geben die stöhnenden Schreie – all das erinnert an Pornofilme. Dass man Sex nicht nur als reine Triebbefriedigung verstehen sollte, macht das Werk allerdings ebenso deutlich. Denn am Ende geht das Spiel für alle doch recht übel aus.
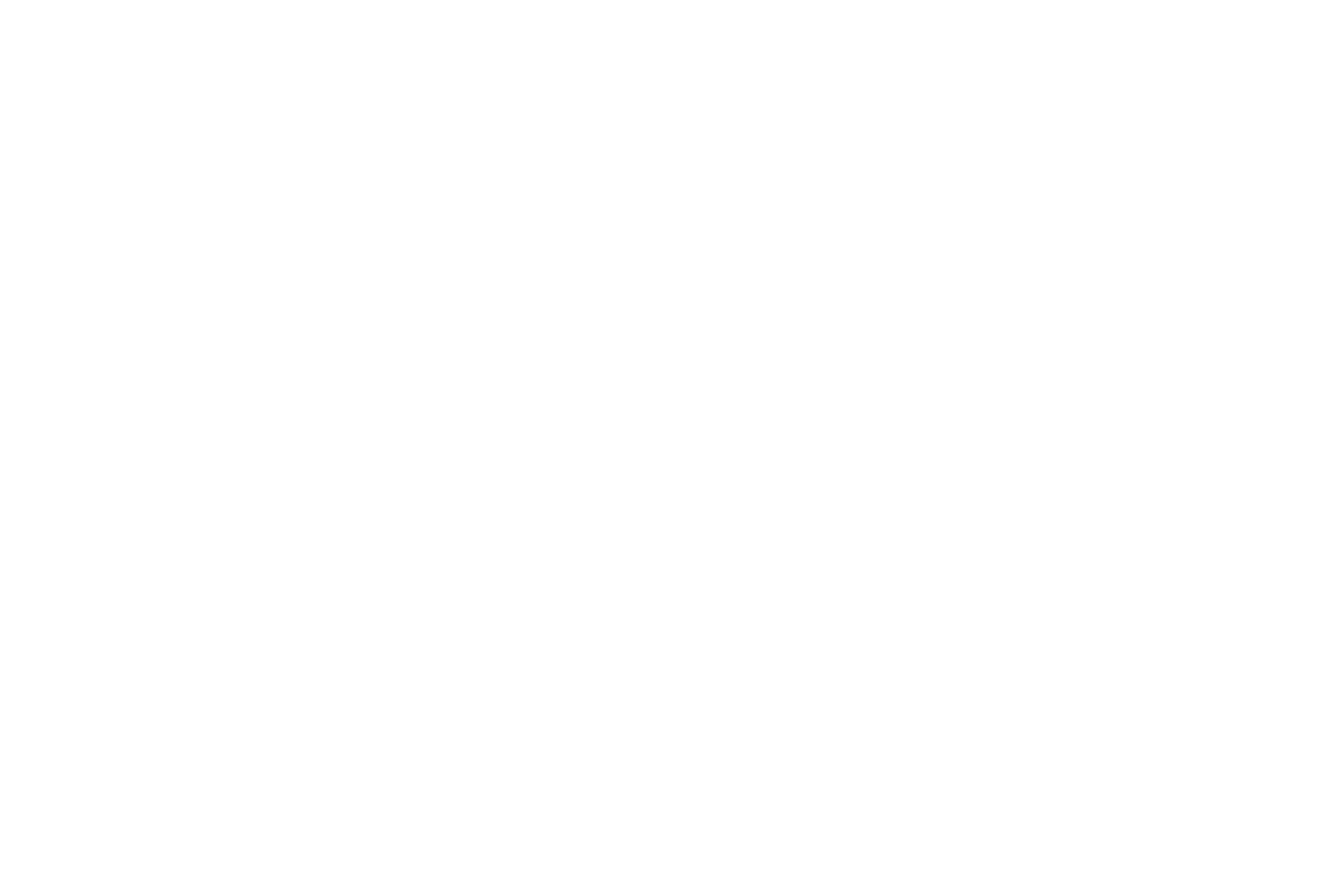
© Monika Rittershaus
Besonders erschütternd ist hier vor allem die permanente Verknüpfung von Sex und Gewalt. Oscar Wildes berühmtes Zitat »Alles im Leben dreht sich um Sex, nur nicht der Sex. Der dreht sich um Macht« wurde selten treffender bestätigt als in Lady Macbeth von Mzensk. Sinnbildlich dafür ist etwa die grausame Vergewaltigung von Aksinja durch das Hofgesinde im ersten Akt. Das anschließende »Rangeln« von Katerina und Sergej eröffnet musikalisch unter der Oberfläche ebenso eine Erotik, die die Pole Gewalt und Sex merkwürdig miteinander vermischt. Noch deutlicher wird die Überschneidung, wenn Boris Sergej im zweiten Akt vor versammelter Truppe genüsslich auspeitscht. In seinem großen Monolog gedenkt der alte Kaufmann zuvor seiner früheren Liebesabenteuer und fasst den Entschluss, seine Schwiegertochter zu vergewaltigen, während diese die Nacht gerade mit Sergej verbringt. Die angestaute Lust von Boris schlägt augenblicklich in grausame Gewalt um, als er Sergej erwischt und auf ihn einzuprügeln beginnt. Die Musik kommentiert die brutalen Peitschenschläge abermals mit schnellem Tempo und den im ersten Akt schon gehörten stoßenden und stampfenden Rhythmen.
Spirale der Gewalt
Es ist also eine Welt voller Gewalt, die man im Stück vor findet. Wie ein Teufelskreis zieht sich die Spirale aus Bösartigkeiten durch die gesamte Erzählung. Boris’ Führungsstil ist auf Terror ausgelegt – gegen die eigene Familie und ebenso gegen alle für ihn Arbeitenden. Die Gewalt überträgt sich von ihm auf alle anderen. Sein Umgang ist mitverantwortlich für das abscheuliche Verhalten des Hofgesindes. Boris ist ebenso Vorbild für seinen Sohn Sinowi, der versucht, seinem Vater ebenbürtig zu sein, dabei jedoch kläglich scheitert. Unterlegt von einer lärmenden Fanfare spielt sich Sinowi im zweiten Akt groß auf, um seine Ehefrau Katerina zur Rede zu stellen. Nachdem diese allerdings schlagfertig reagiert und er ihr mit Worten nichts mehr entgegenzusetzen weiß, wendet er Gewalt an und verprügelt Katerina mit dem Gürtel – wie er es von seinem Vater gelernt hat. Doch Gewalt führt immer nur zu weiterer Gewalt, und Sinowi wird kurzerhand von Sergej und Katerina ermordet.
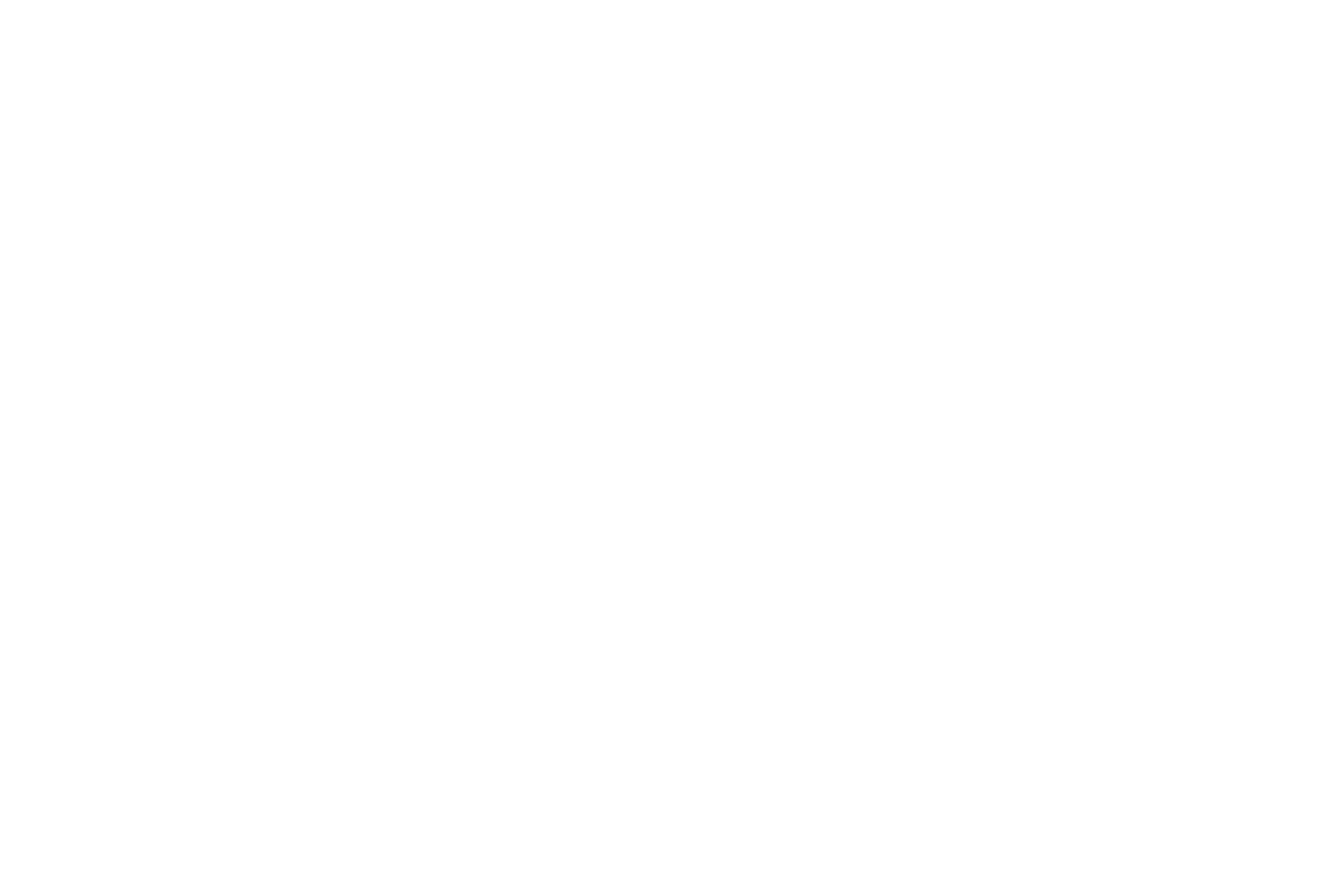
© Monika Rittershaus
Betrachtet man in diesem Konstrukt die Hauptperson selbst, so stellt man fest, dass auch Katerina den Regeln ihrer Umwelt folgt. In einer grauenvollen Welt greift sie selbst zu grauenvollen Mitteln. Dennoch eröffnen ihre Monologe ein seelisches Bild, das im Gegensatz zu den anderen Figuren unser Mitgefühl weckt. Gerade das war Schostakowitschs Ziel, als er sich entschied, aus Nikolai Leskows Novelle Lady Macbeth des Mzensker Landkreises eine Oper zu machen. Leskows Titel übernahm Schostakowitsch hierbei wortgetreu: »Ledi Makbet Mzenskowo ujesda«. Anders als im Russischen hat sich hierzulande die vereinfachte Form »Lady Macbeth von Mzensk« durchgesetzt.
Shakespeare im Dorfe
Für Schostakowitsch eignete sich Leskows Novelle von 1865 dazu, die prekäre Lage der Frau im Russland der düsteren Zarenzeit aus der Sicht der 1930er Jahre darzustellen – aus Katerina wurde bei Schostakowitsch somit eine tragische Figur. Die Katerina der ursprünglichen Novelle war eigentlich noch eine kaltblütige Mörderin, die aus reiner Triebhaftigkeit und Habgier ihre Morde beging. Der Werktitel erklärte sich somit vor allem aus dieser Darstellung heraus: Auch Shakespeares Lady Macbeth handelt schließlich skrupellos und egoistisch. Der Bezug auf Shakespeare war zu Zeiten Leskows ein durchaus beliebtes Mittel in der Titelgebung von Stücken, wie unter anderem auch die Novelle Ein König Lear der Steppe von Iwan Turgenjew belegt. Schostakowitsch äußerte sich dazu wie folgt:
»Die ›Lady Macbeth des Mzensker Landkreises‹ als Werk selbst wird von mir auf andere Weise interpretiert als bei Leskow. Wie schon allein aus dem Titel ersichtlich ist, geht er an die beschriebenen Ereignisse ironisch heran – ›Lady Macbeth des Mzensker Landkreises‹. Diese Titelgebung weist auf eine unbedeutende Gegend hin, auf einen kleinen Landkreis, wo die Helden nur kleine Charaktere sind, mit kleineren Leidenschaften und Interessen als bei Shakespeare. Außerdem konnte Leskow als hervorragender Vertreter der vorrevolutionären Literatur keine wahre Erklärung für jene Ereignisse, von welchen seine Erzählung handelt, geben.«
Besagte Erklärung für Katerinas Handeln wollte nun also Schostakowitsch in seiner Oper herausarbeiten. Um seine neue Sichtweise auf den Stoff zu realisieren, nahm der Komponist einige Änderungen vor. Bei Leskow begeht die Titelfigur beispielsweise noch einen weiteren Mord an ihrem unschuldigen Neffen und verstößt das eigene Baby, nachdem sie von Sergej geschwängert wurde. Schostakowitsch strich diese Sequenzen heraus und konzipierte gemeinsam mit seinem Librettisten Alexander Preis stattdessen den dritten Akt mit Polizei- und Hochzeitsszene, in dem das Schuldgefühl von Katerina nach den Morden thematisiert wird. Die neu eingeführte, für Katerina demütigende Abschiedsszene im ersten Akt sowie die Ausschmückung der brutalen Sequenz, wenn Boris Sergej verprügelt, halfen zusätzlich dabei, Katerinas Beweggründe nachzuvollziehen: Verlief ihr Leben bei Leskow bis zu den Morden relativ ereignislos, zeigt Schostakowitsch seine Titelheldin von Anfang an als eine Frau, die schon seit Jahren unter schrecklichsten Bedingungen lebt.
Alles langweilt sich
In ihren großen Monologen erhält Katerina zudem die Möglichkeit, ihr Inneres zu offenbaren. Ein wichtiges Motiv ist hierbei die Langeweile: »skuka«. Im Gegensatz zu Leskow äußert sich diese Langeweile Katerinas bei Schostakowitsch als tiefe Verzweiflung und Depression angesichts eines unerfüllten Lebens. In einer finsteren Welt sucht Katerina nach einem Lebenssinn. Sie glaubt, diesen vor allem in der Befriedigung ihres Sexualtriebes zu finden, was kaum überrascht, da es ihr so auch von der Außenwelt vorgelebt wird. Denn letztlich langweilen sich alle im Stück: Boris, das Hofgesinde, Sergej, die Polizei, der Schäbige. Die Langeweile wird dabei von allen im Triebhaften bekämpft – in Gewaltakten, Alkohol, Sex oder oberflächlicher Sensationslust. Zu spät erkennt Katerina, dass ihre Depression sich nicht durch die temporäre Befriedigung jener Triebe heilen lässt. Zu spät erkennt sie den toxischen Charakter Sergejs. Zu spät versteht sie, dass sie sich in die vollkommene Abhängigkeit eines rücksichtslosen Frauenhelden begeben hat. Aus »skuka« wird im finalen vierten Akt nun das Wort »muka« – die Qual. Bis zum bitteren Schluss haben wir Mitleid mit Katerina. Doch auch wenn Schostakowitschs Titelheldin keine triebhafte Verbrecherin mehr ist wie bei Leskow, wäre es ebenso falsch, sie als vollkommen rein und schuldlos zu sehen. Gerade dieser Widerspruch ihres Charakters ist es, der uns so fasziniert zurücklässt.
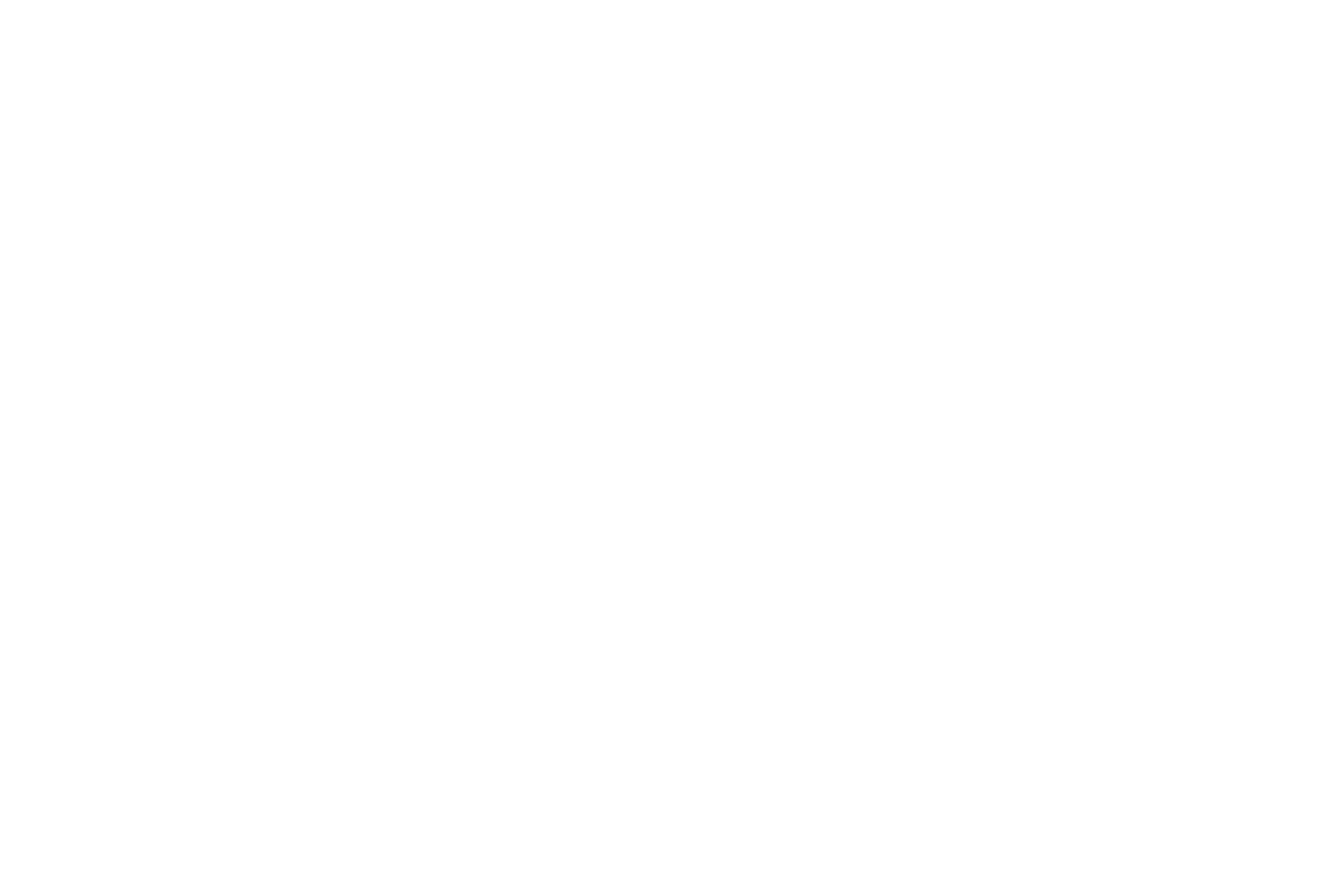
© Monika Rittershaus
Gesellschaftliches Drama
Im Finale der Oper wird das Scheitern der Hauptfigur durch Hinzunahme des Chors der Strafgefangenen letztlich zum Scheitern eines ganzen Volkes. Die individuelle Tragödie entwickelt sich somit zum gesellschaftlichen Drama – ein Drama, das Schostakowitsch seinerzeit auf das alte Zarenrussland bezog, nur um bald festzustellen, dass es im Sowjetrussland Stalins weiterhin allzu präsent war. Es ist ein Opernende in vollkommener Hoffnungslosigkeit: »Unsere Gedanken sind freudlos und die Wachen sind herzlos«. Dass man einen Spiegel der Welt in ihrer vollen Hässlichkeit nur ungern vorgesetzt bekommt, ist verständlich. Und dennoch notwendig. Selten wurden jedenfalls die dunklen Seiten des Menschen packender in einer Oper präsentiert. Die bisweilen heute noch als anstößig empfundenen Szenen sind hierbei nicht einfach plumpes Beiwerk eines Erotikthrillers. Sie zeigen die Abgründe des Menschen und bringen Ursache und Wirkung von Gewalt ans Licht. Schostakowitsch zeigt uns, wie Kunstporno gehen kann.
KOBLadyMacbeth
27. Januar 2026
Ein Schlag ins Gesicht
Ein Gespräch mit Dirigent James Gaffigan über die russische Sprache, extremes Musiktheater und die Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit
#KOBLadyMacbeth
Interview
27. Januar 2026
Dorf der Verlorenen
Ein Gespräch mit Regisseur Barrie Kosky über einen jungen Komponisten, eine rätselhafte Mörderin und ein Landgut ohne Klimaanlage in Lady Macbeth von Mzensk
#KOBLadyMacbeth
Interview