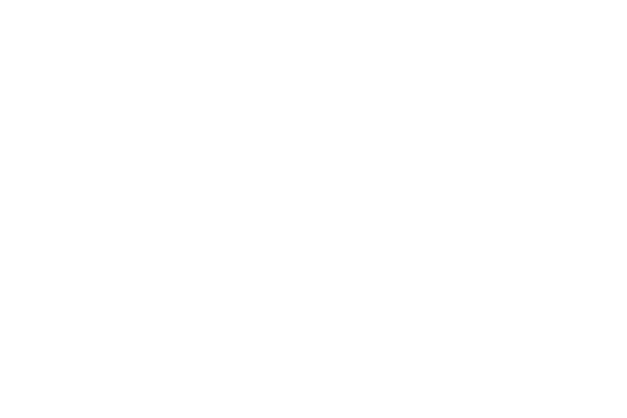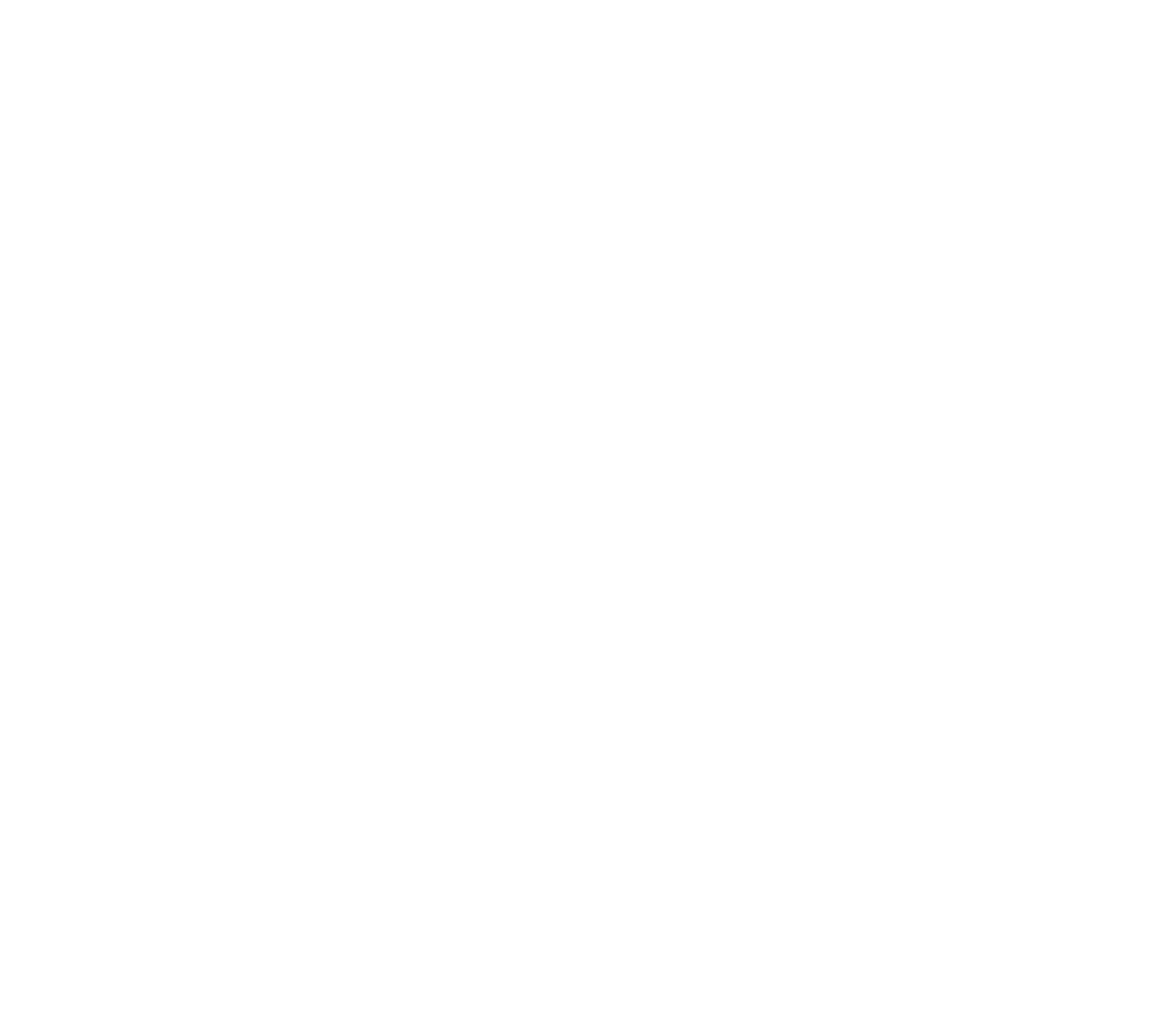© Iko Freese / drama-berlin.de
Wo ein Wille ist
Regisseur Barrie Kosky und Dirigent Adam Benzwi im Gespräch über Schutzengel, Wiener Wohnzimmer, eiskalten Martini und ihre Inzenenierung Eine Frau, die weiss, was sie will!
Operette an der Komischen Oper Berlin – das verspricht meist große Opulenz auf der Bühne. Eine Frau, die weiß, was sie will! geht einen anderen Weg …
Barrie Kosky Obwohl Eine Frau, die weiß, was sie will! seinerzeit in dem für seine Opulenz ja berühmten Metropol-Theater (der heutigen Komischen Oper Berlin) uraufgeführt wurde, wäre es in meinen Augen nicht richtig, dieses Werk als große Ausstattungsoperette zu inszenieren, weil es im Kern ein Kammerspiel ist. Inhaltlich steht es in der Tradition der »Backstage-Komödien«, die ihren spektakulären Höhepunkt in den Hollywood-Komödien der 1940er und frühen 50er Jahre hatte, mit Darstellern wie Judy Garland und Mickey Rooney. Wenig erinnert da an Bühnenspektakel wie Die schöne Helena, Ball im Savoy oder Clivia.
Adam Benzwi So kommt Eine Frau, die weiß, was sie will! zum Beispiel ganz ohne den Rausch von Tanzbein und Chor aus. Auch ist das Orchester bei Oscar Straus nicht groß besetzt. Selbst, dass zwei Figuren ein Duett miteinander singen, ist selten: Alles in dieser Operette ist auf den einzelnen Darsteller fokussiert …
Barrie Kosky … der bei Oscar Straus zudem vieleher als singender Schauspieler denn als Opernsänger angelegt ist. Man braucht für diese Art von Stücken Darsteller, die den Witz, das Tempo und eine spezielle Art von Humor mitbringen und technisch umsetzen können. Als ich das Werk kennenlernte, kamen mir sofort Dagmar Manzel und Max Hopp in den Sinn. Ich fand den Gedanken reizvoll, Eine Frau, die weiß, was sie will! als Zweipersonenstück für die beiden anzulegen und zu einer verrückten Farce zuzuspitzen. Der Kern der Operette ist dabei derselbe geblieben, nur haben wir eine andere Form gewählt, das Werk zu erzählen – nämlich mit Mitteln des Vaudevilles.
Elemente aus dem Vaudeville – einer Unterhaltungsform, die insbesondere ab Mitte des 19. Jahrhunderts auf großstädtischen Varieté- und Revuebühnen sowie in Music Halls ihren Siegeszug antrat – finden immer wieder Eingang in Ihre Regiearbeit. Was fasziniert Sie daran?
Barrie Kosky Für mich ist Vaudeville in erster Linie eine musikalische Form der Commedia dell’arte: Ähnlich wie die Commedia arbeitet auch das Vaudeville mit typisierten Figuren. Seine Protagonisten haben gesungen, gespielt und getanzt, manche waren Akrobaten, Zauberer oder Illusionisten. Ich finde diese Vielfalt wunderbar. Das Vaudeville bestand aus drei- bis fünfminütigen »Nummern«. Das kann man noch gut in den Filmen der Marx Brothers beobachten: Die sind allesamt von kurzen, sehr präzise gearbeiteten »Vaudeville-Routines« durchzogen. Seine Apotheose erreichte das Vaudeville, als es »salonfähig« wurde und begann, die große Bühne zu erobern. Samuel Beckett etwa hat aus dem Vaudeville die Inspiration für einige seiner wichtigsten Stücke gezogen, seine Lieblingsschauspieler von Warten auf Godot waren nicht umsonst alte englische Vaudeville-Darsteller …
Hierzulande wird Vaudeville oft fälschlicherweise mit »Slapstick« oder »Show« gleichgesetzt und als Gegenbegriff zur »deutschen Hochkultur« gesehen. Das ist bedauerlich, zumal es gerade in Berlin einst eine sehr reiche Vaudeville-Tradition gegeben hat, die zu Beginn der 1930er Jahre mit Darstellern wie Oskar Dénes und Rosy Barsony einen Höhepunkt erreichte. In meiner Arbeit geht es mir jedoch nicht darum, Vaudeville als eigene Form zu präsentieren. Vielmehr besteht für mich der Reiz darin, Elemente des Vaudevilles in andere Gattungen zu integrieren – es als Zutat etwa in Opern oder Operetten zu nutzen.
Barrie Kosky Obwohl Eine Frau, die weiß, was sie will! seinerzeit in dem für seine Opulenz ja berühmten Metropol-Theater (der heutigen Komischen Oper Berlin) uraufgeführt wurde, wäre es in meinen Augen nicht richtig, dieses Werk als große Ausstattungsoperette zu inszenieren, weil es im Kern ein Kammerspiel ist. Inhaltlich steht es in der Tradition der »Backstage-Komödien«, die ihren spektakulären Höhepunkt in den Hollywood-Komödien der 1940er und frühen 50er Jahre hatte, mit Darstellern wie Judy Garland und Mickey Rooney. Wenig erinnert da an Bühnenspektakel wie Die schöne Helena, Ball im Savoy oder Clivia.
Adam Benzwi So kommt Eine Frau, die weiß, was sie will! zum Beispiel ganz ohne den Rausch von Tanzbein und Chor aus. Auch ist das Orchester bei Oscar Straus nicht groß besetzt. Selbst, dass zwei Figuren ein Duett miteinander singen, ist selten: Alles in dieser Operette ist auf den einzelnen Darsteller fokussiert …
Barrie Kosky … der bei Oscar Straus zudem vieleher als singender Schauspieler denn als Opernsänger angelegt ist. Man braucht für diese Art von Stücken Darsteller, die den Witz, das Tempo und eine spezielle Art von Humor mitbringen und technisch umsetzen können. Als ich das Werk kennenlernte, kamen mir sofort Dagmar Manzel und Max Hopp in den Sinn. Ich fand den Gedanken reizvoll, Eine Frau, die weiß, was sie will! als Zweipersonenstück für die beiden anzulegen und zu einer verrückten Farce zuzuspitzen. Der Kern der Operette ist dabei derselbe geblieben, nur haben wir eine andere Form gewählt, das Werk zu erzählen – nämlich mit Mitteln des Vaudevilles.
Elemente aus dem Vaudeville – einer Unterhaltungsform, die insbesondere ab Mitte des 19. Jahrhunderts auf großstädtischen Varieté- und Revuebühnen sowie in Music Halls ihren Siegeszug antrat – finden immer wieder Eingang in Ihre Regiearbeit. Was fasziniert Sie daran?
Barrie Kosky Für mich ist Vaudeville in erster Linie eine musikalische Form der Commedia dell’arte: Ähnlich wie die Commedia arbeitet auch das Vaudeville mit typisierten Figuren. Seine Protagonisten haben gesungen, gespielt und getanzt, manche waren Akrobaten, Zauberer oder Illusionisten. Ich finde diese Vielfalt wunderbar. Das Vaudeville bestand aus drei- bis fünfminütigen »Nummern«. Das kann man noch gut in den Filmen der Marx Brothers beobachten: Die sind allesamt von kurzen, sehr präzise gearbeiteten »Vaudeville-Routines« durchzogen. Seine Apotheose erreichte das Vaudeville, als es »salonfähig« wurde und begann, die große Bühne zu erobern. Samuel Beckett etwa hat aus dem Vaudeville die Inspiration für einige seiner wichtigsten Stücke gezogen, seine Lieblingsschauspieler von Warten auf Godot waren nicht umsonst alte englische Vaudeville-Darsteller …
Hierzulande wird Vaudeville oft fälschlicherweise mit »Slapstick« oder »Show« gleichgesetzt und als Gegenbegriff zur »deutschen Hochkultur« gesehen. Das ist bedauerlich, zumal es gerade in Berlin einst eine sehr reiche Vaudeville-Tradition gegeben hat, die zu Beginn der 1930er Jahre mit Darstellern wie Oskar Dénes und Rosy Barsony einen Höhepunkt erreichte. In meiner Arbeit geht es mir jedoch nicht darum, Vaudeville als eigene Form zu präsentieren. Vielmehr besteht für mich der Reiz darin, Elemente des Vaudevilles in andere Gattungen zu integrieren – es als Zutat etwa in Opern oder Operetten zu nutzen.
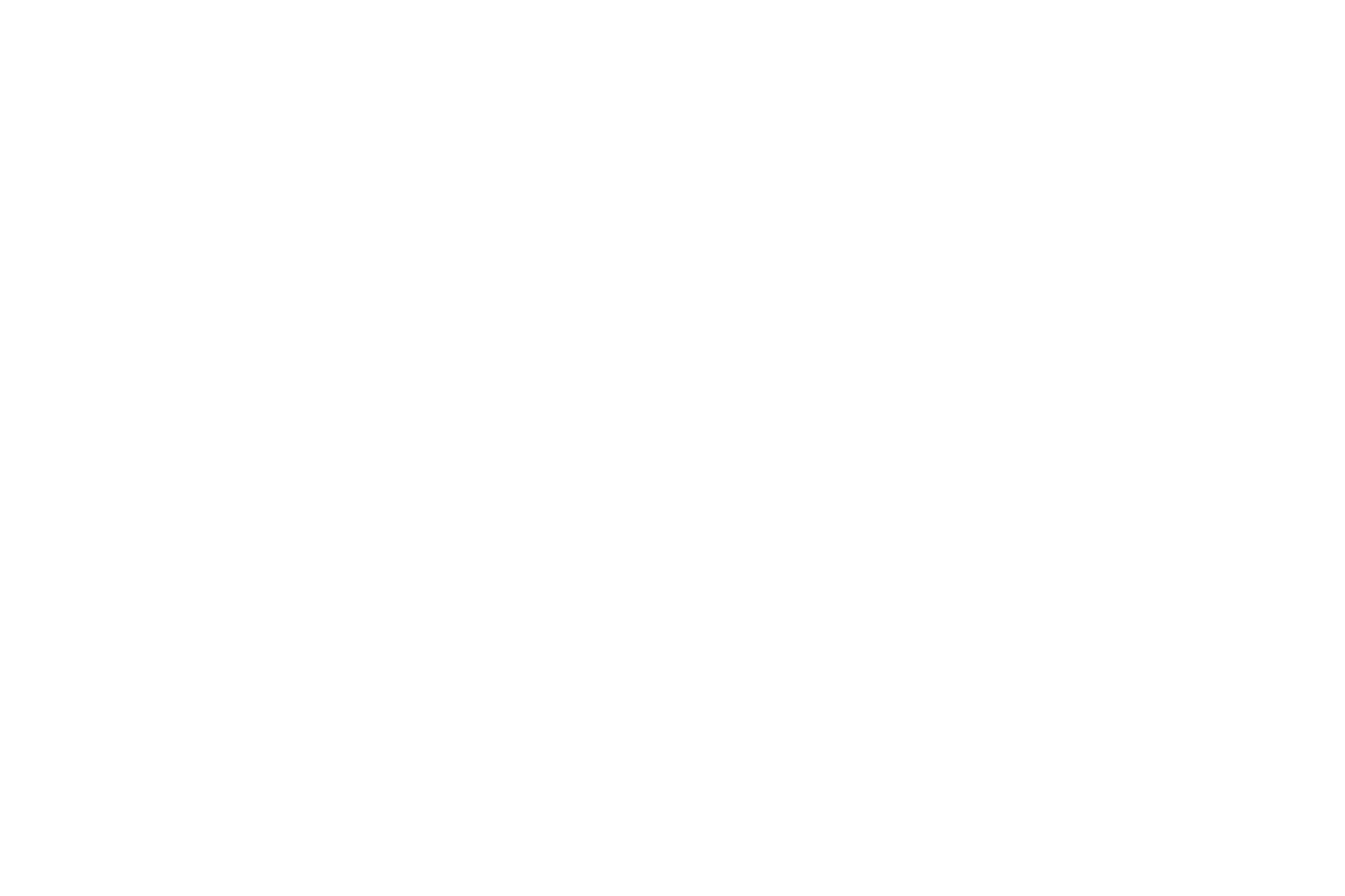
© Iko Freese / drama-berlin.de
Oscar Straus selbst bezeichnete Eine Frau, die weiß, was sie will! nicht als Operette …
Adam Benzwi … sondern als »Musikalische Komödie«, und ich finde diese Differenzierung nicht unwichtig. Für mich steht das Werk eher in der Traditionslinie der frühen amerikanischen Musical Comedys, der »Musicals«, als in der Operettentradition. Was mich an Eine Frau, die weiß, was sie will! begeistert, ist, dass Oscar Straus hier die feine Chanson-Kultur des Kabaretts auf die große Bühne hebt und sie dort zelebriert, ohne ihre Intimität zu zerstören. Schon in jungen Jahren hatte er als Komponist und Kapellmeister an Ernst von Wolzogens Berliner Überbrettl-Theater das musikalische Kabarett maßgeblich geprägt und dabei gelernt, wie er den singenden Schauspieler mit seiner Kompositionsweise unterstützen kann: Straus hatte die Größe, so zu komponieren, dass seine Musik dem Text
dient – es ist eine zurückgenommene, geradezu höfliche Musik, die es dem Darsteller erlaubt, seinen Text mit Leichtigkeit zu servieren, damit die Pointen zünden können. Straus ist keiner, der in die musikalische Trickkiste greift, um Effekte zu erheischen.
Barrie Kosky Das Überbrettl war sicher eine gute Schule. Und es wäre bestimmt höchst interessant gewesen, als Fliege an der Wand bei Proben in diesem Kabarett dabei zu sein … Denn nicht nur Oscar Straus, sondern auch der junge Arnold Schönberg war dort Kapellmeister. Für mich ist eine der köstlichsten Geschichten des 20. Jahrhunderts, dass Schönberg als junger Künstler tagsüber Operetten orchestrierte, abends im Kabarett tätig war und nachts an Werken wie Verklärte Nacht arbeitete. Ansonsten verbindet die Überbrettl-Kollegen Straus und Schönberg natürlich nicht sehr viel – außer der Tatsache, dass beide später auf der Höhe ihres Schaffens Deutschland verlassen mussten.
Zu seinen Lebzeiten galt Oscar Straus international als einer der erfolgreichsten und meistgespielten Komponisten. Warum sind seine Werke heute so selten auf den Spielplänen präsent?
Barrie Kosky In der Tat ist Oscar Straus heute zu Unrecht überschattet von Lehár oder der großen Kálmán-Renaissance. Vielleicht liegt ein Grund darin, dass er zwischen den Welten stand: Er war ein Bindeglied zwischen der üppig-romantischen Wiener Walzerwelt von Johann Strauss und Franz Lehár und den quirlig-jazzigen Klängen von Emmerich Kálmán oder Paul Abraham. Oscar Straus liefert eine andere, sehr eigene Farbe, die ihn zu einem wichtigen Baustein im Gebäude der Operette macht. Seine Welt ist der Salon, und selbst wenn seine Operetten nicht in Salons spielen, fühlt man sich bei ihnen immer wie in einem Wiener Wohnzimmer. Straus klingt wie eiskalter trockener Martini mit zwei Oliven. Seine größte Gabe war es, unglaubliche Melodien komponieren zu können – und einige seiner besten Melodien hat er für Eine Frau, die weiß, was sie will! geschrieben.
Adam Benzwi Diese Melodien mögen auf der Oberfläche gefällig erscheinen: Es ist ein geschmackvoller Klang, der sehr elegant und »sophisticated« wirkt. Doch das Piekfein-Bürgerliche daran bricht Straus immer wieder mit einem frechen Augenzwinkern. Im dem Lied »Ninon« etwa ist in den Strophen sehr gesittet von hochehrwürdigen Personen wie Louis XV. oder Voltaire die Rede, aber im Refrain geht die Post ab. Da heißt es dann: »Sah sie einen Mann, dann fragte sie: Wann? Dann musste er einfach ’ran«, mit einer galoppierenden Musik dazu, die vor offener Erotik nur so strotzt. Für mich ist da ein gehöriger Schuss Berliner Schnauze mit dabei, und nicht umsonst ist das Werk an der Spree und nicht in Oscar Straus’ Heimatstadt Wien uraufgeführt worden.
Adam Benzwi … sondern als »Musikalische Komödie«, und ich finde diese Differenzierung nicht unwichtig. Für mich steht das Werk eher in der Traditionslinie der frühen amerikanischen Musical Comedys, der »Musicals«, als in der Operettentradition. Was mich an Eine Frau, die weiß, was sie will! begeistert, ist, dass Oscar Straus hier die feine Chanson-Kultur des Kabaretts auf die große Bühne hebt und sie dort zelebriert, ohne ihre Intimität zu zerstören. Schon in jungen Jahren hatte er als Komponist und Kapellmeister an Ernst von Wolzogens Berliner Überbrettl-Theater das musikalische Kabarett maßgeblich geprägt und dabei gelernt, wie er den singenden Schauspieler mit seiner Kompositionsweise unterstützen kann: Straus hatte die Größe, so zu komponieren, dass seine Musik dem Text
dient – es ist eine zurückgenommene, geradezu höfliche Musik, die es dem Darsteller erlaubt, seinen Text mit Leichtigkeit zu servieren, damit die Pointen zünden können. Straus ist keiner, der in die musikalische Trickkiste greift, um Effekte zu erheischen.
Barrie Kosky Das Überbrettl war sicher eine gute Schule. Und es wäre bestimmt höchst interessant gewesen, als Fliege an der Wand bei Proben in diesem Kabarett dabei zu sein … Denn nicht nur Oscar Straus, sondern auch der junge Arnold Schönberg war dort Kapellmeister. Für mich ist eine der köstlichsten Geschichten des 20. Jahrhunderts, dass Schönberg als junger Künstler tagsüber Operetten orchestrierte, abends im Kabarett tätig war und nachts an Werken wie Verklärte Nacht arbeitete. Ansonsten verbindet die Überbrettl-Kollegen Straus und Schönberg natürlich nicht sehr viel – außer der Tatsache, dass beide später auf der Höhe ihres Schaffens Deutschland verlassen mussten.
Zu seinen Lebzeiten galt Oscar Straus international als einer der erfolgreichsten und meistgespielten Komponisten. Warum sind seine Werke heute so selten auf den Spielplänen präsent?
Barrie Kosky In der Tat ist Oscar Straus heute zu Unrecht überschattet von Lehár oder der großen Kálmán-Renaissance. Vielleicht liegt ein Grund darin, dass er zwischen den Welten stand: Er war ein Bindeglied zwischen der üppig-romantischen Wiener Walzerwelt von Johann Strauss und Franz Lehár und den quirlig-jazzigen Klängen von Emmerich Kálmán oder Paul Abraham. Oscar Straus liefert eine andere, sehr eigene Farbe, die ihn zu einem wichtigen Baustein im Gebäude der Operette macht. Seine Welt ist der Salon, und selbst wenn seine Operetten nicht in Salons spielen, fühlt man sich bei ihnen immer wie in einem Wiener Wohnzimmer. Straus klingt wie eiskalter trockener Martini mit zwei Oliven. Seine größte Gabe war es, unglaubliche Melodien komponieren zu können – und einige seiner besten Melodien hat er für Eine Frau, die weiß, was sie will! geschrieben.
Adam Benzwi Diese Melodien mögen auf der Oberfläche gefällig erscheinen: Es ist ein geschmackvoller Klang, der sehr elegant und »sophisticated« wirkt. Doch das Piekfein-Bürgerliche daran bricht Straus immer wieder mit einem frechen Augenzwinkern. Im dem Lied »Ninon« etwa ist in den Strophen sehr gesittet von hochehrwürdigen Personen wie Louis XV. oder Voltaire die Rede, aber im Refrain geht die Post ab. Da heißt es dann: »Sah sie einen Mann, dann fragte sie: Wann? Dann musste er einfach ’ran«, mit einer galoppierenden Musik dazu, die vor offener Erotik nur so strotzt. Für mich ist da ein gehöriger Schuss Berliner Schnauze mit dabei, und nicht umsonst ist das Werk an der Spree und nicht in Oscar Straus’ Heimatstadt Wien uraufgeführt worden.
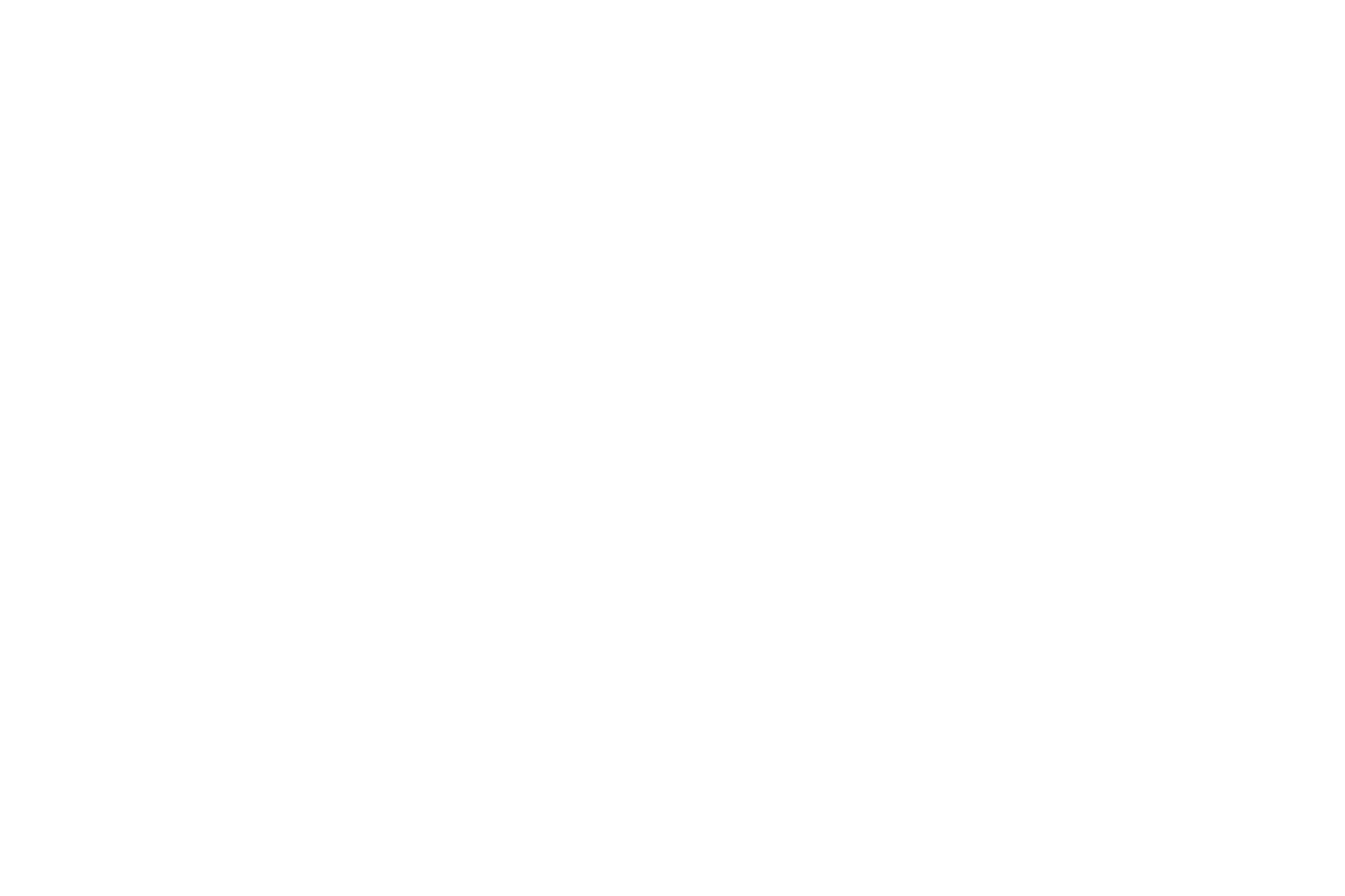
© Iko Freese / drama-berlin.de
Uraufgeführt wurde Eine Frau, die weiß, was sie will! 1932, wenige Monate vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Schlägt sich die politisch aufgeheizte Zeit in irgendeiner Form in dem Werk nieder?
Adam Benzwi Ich finde, das Werk ist beängstigend unbeschwert – anders als etwa Paul Abrahams Ball im Savoy (auch 1932), das in seiner manischen Überdrehtheit vielleicht als ein Schwanengesang der Weimarer Republik verstanden werden kann.
Barrie Kosky Oscar Straus war nicht interessiert an dem »Tanz auf dem Vulkan«. Er war interessiert daran, eine verdrehte Boulevardkomödie zu schreiben. Bemerkenswert allerdings ist, dass wieder einmal – in bester Offenbach-Tradition – eine außergewöhnliche, emanzipierte Frau im Mittelpunkt der Operette steht, die unzählige Male smarter ist als alle Männer auf der Bühne. Interessant finde ich, dass die großen sozialen Umwälzungen der 1920er und 30er Jahre – etwa die veränderte Rolle der Frau in der modernen Gesellschaft – gerade im »popular entertainment« reflektiert wurden. In der Oper und in gewisser Weise auch im Schauspiel der Zeit wurden diese Themen meist nicht so radikal behandelt wie in der Operette – was historisch gesehen nur folgerichtig ist, weil die Operette immer schon eine äußerst subversive Kunstform war.
Die Gallionsfigur der Berliner Operette der Zeit war die legendäre Fritzi Massary, der zahlreiche Operetten direkt »auf den Leib« komponiert wurden, u. a. auch Eine Frau, die weiß, was sie will! Wirkt der Einfluss dieser Jahrhundertdiva noch heute nach?
Barrie Kosky Fritzi Massary war jahrzehntelang die regierende Königin der Operette in der deutschsprachigen Welt. Sie hat das Metropol-Theater über viele Jahre hinweg geprägt, und ihre Tonaufnahmen zeugen noch heute davon, wie einzigartig sie war. Aber wir können und wollen weder sie noch die Originalproduktion rekreieren. Allerdings glaube ich fest daran, dass Fritzi Massary einer der Schutzengel dieses Theaters ist.
Adam Benzwi In einem Fernsehinterview, das sie hochbetagt im kalifornischen Exil gegeben hat, sagt Fritzi Massary im Rückblick auf ihre Berliner Jahre, dass es ihr in ihrer Arbeit immer darum gegangen sei, in allen Liedern und Texten Tiefe und Wahrhaftigkeit zu entdecken – mochten sie auf der Oberfläche noch so trivial erscheinen. Sie sagt auch, dass sie es geliebt habe, dasselbe Stück – wie damals üblich – an oft hundert Abenden hintereinander zu spielen, weil sie es als Chance verstanden habe, Neues im Stück zu entdecken und noch tiefer in ihre Rolle einzutauchen. Immer wieder Neues entdecken zu wollen und dabei nach der tieferen Wahrheit zu streben – das empfinde ich auch heute noch als das Entscheidende.
Adam Benzwi Ich finde, das Werk ist beängstigend unbeschwert – anders als etwa Paul Abrahams Ball im Savoy (auch 1932), das in seiner manischen Überdrehtheit vielleicht als ein Schwanengesang der Weimarer Republik verstanden werden kann.
Barrie Kosky Oscar Straus war nicht interessiert an dem »Tanz auf dem Vulkan«. Er war interessiert daran, eine verdrehte Boulevardkomödie zu schreiben. Bemerkenswert allerdings ist, dass wieder einmal – in bester Offenbach-Tradition – eine außergewöhnliche, emanzipierte Frau im Mittelpunkt der Operette steht, die unzählige Male smarter ist als alle Männer auf der Bühne. Interessant finde ich, dass die großen sozialen Umwälzungen der 1920er und 30er Jahre – etwa die veränderte Rolle der Frau in der modernen Gesellschaft – gerade im »popular entertainment« reflektiert wurden. In der Oper und in gewisser Weise auch im Schauspiel der Zeit wurden diese Themen meist nicht so radikal behandelt wie in der Operette – was historisch gesehen nur folgerichtig ist, weil die Operette immer schon eine äußerst subversive Kunstform war.
Die Gallionsfigur der Berliner Operette der Zeit war die legendäre Fritzi Massary, der zahlreiche Operetten direkt »auf den Leib« komponiert wurden, u. a. auch Eine Frau, die weiß, was sie will! Wirkt der Einfluss dieser Jahrhundertdiva noch heute nach?
Barrie Kosky Fritzi Massary war jahrzehntelang die regierende Königin der Operette in der deutschsprachigen Welt. Sie hat das Metropol-Theater über viele Jahre hinweg geprägt, und ihre Tonaufnahmen zeugen noch heute davon, wie einzigartig sie war. Aber wir können und wollen weder sie noch die Originalproduktion rekreieren. Allerdings glaube ich fest daran, dass Fritzi Massary einer der Schutzengel dieses Theaters ist.
Adam Benzwi In einem Fernsehinterview, das sie hochbetagt im kalifornischen Exil gegeben hat, sagt Fritzi Massary im Rückblick auf ihre Berliner Jahre, dass es ihr in ihrer Arbeit immer darum gegangen sei, in allen Liedern und Texten Tiefe und Wahrhaftigkeit zu entdecken – mochten sie auf der Oberfläche noch so trivial erscheinen. Sie sagt auch, dass sie es geliebt habe, dasselbe Stück – wie damals üblich – an oft hundert Abenden hintereinander zu spielen, weil sie es als Chance verstanden habe, Neues im Stück zu entdecken und noch tiefer in ihre Rolle einzutauchen. Immer wieder Neues entdecken zu wollen und dabei nach der tieferen Wahrheit zu streben – das empfinde ich auch heute noch als das Entscheidende.
Mehr dazu
10. März 2024
Dem glühenden Operettenfan Barrie Kosky ist mit »Eine Frau, die weiß, was sie will!« endlich wieder ein glaubhaftes Plädoyer für die subversive Kraft dieses Genres gelungen … Sein Konzept geht so brillant auf, dass es das Publikum schier vom Hocker reißt und der Abend am Ende mit stehenden Ovationen bejubelt wird.
Emotionale Unverstelltheit
Julia Spinola, Deutschlandfunk
Julia Spinola, Deutschlandfunk
#KOBEineFrau
7. März 2024
Bald wieder da: Eine Frau, die weiß, was sie will!
Mit Oscar Straus’ Eine Frau, die weiß, was sie will! knüpft Barrie Kosky einmal mehr an die Tradition der Komischen Oper Berlin vor 1933 an: Das Operettenschmuckstück feierte 1932 am selben Haus, damals das Metropol-Theater, mit Fritzi Massary in der Titelrolle seine umjubelte Uraufführung. Ab 22. März kehrt es für nur fünf Vorstellungen als verrückte Tour de Force nach Berlin zurück: Im Zweipersonenstück schlüpfen das Operetten-Dreamteam Dagmar Manzel und Max Hopp in 20 verschiedene Rollen und spielen sich quer durch die Geschlechter … Wiener Schmelz trifft auf Berliner Bissigkeit – unser Orchester unter Adam Benzwi heizt mit einem furiosen Feuerwerk an flotten Märschen, stürmischen Walzern und unvergleichlichen Chansons wie »Die Sache, die sich Liebe nennt« und »Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben?« ordentlich ein.
»Nach knapp 90 Minuten fühlt man sich völlig beschwipst von so viel Energie, Geist und Witz.« [Berliner Morgenpost]
»Nach knapp 90 Minuten fühlt man sich völlig beschwipst von so viel Energie, Geist und Witz.« [Berliner Morgenpost]
KOBEineFrau
7. März 2024
Es ist ein Triumph. Für Dagmar Manzel und Max Hopp, die an diesem umjubelten Premierenabend in 20 verschiedene Rollen schlüpfen. Für Barrie Kosky, der Oscar Straus’ »Eine Frau, die weiß, was sie will!« mit virtuoser Regisseurshand als Zwei-Personen-Stück arrangiert hat. Und auch für das neue Geschichtsbewusstsein an der Komischen Oper, das auch die Zeiten vor Walter Felsenstein und seinem realistischen Musiktheater reflektiert. Unter dem Namen »Metropol Theater« residierte seit 1897 an der Behrenstraße eines der mondänsten Vergnügungsetablissements der Reichshauptstadt.
Meine Mama ist ’ne Diva
Frederik Hanssen, Der Tagesspiegel
Frederik Hanssen, Der Tagesspiegel
#KOBEineFrau
6. März 2024
Spielwut von Knast bis Klapse
Dagmar Manzel und Max Hopp über Tempo, Sandkästen und die Schauspielerei in Eine Frau, die weiß, was sie will.
#KOBEineFrau
3. März 2024
Umwerfend. Überwältigend. Überrumpelnd. Es gibt keine anderen Bezeichnungen, um die Neuproduktion der Komischen Oper in Berlin zu beschreiben.
Das ist ein wahnsinniges Maskenspiel
Tilman Krause, Die Welt
Tilman Krause, Die Welt
#KOBEineFrau
29. Februar 2024
Befreites Lachen füllt den Saal. Die Dummheit ist besiegt. Die große Kunst des Metropol ist wieder da mit all ihrem Glanz und Witz, und mit ihrem Spott und Hohn gegen die Lügner aller Klassen. Sie wird bleiben.
Das Metropol-Theater ist zurückgekehrt
Niklaus Hablützel, taz
Niklaus Hablützel, taz
#KOBEineFrau
31. Januar 2015
Damit ist in dieser Aufführung tatsächlich alles drin, von überdrehtem Tingel-Tangel bis zur eindringlichen Jazz-Ballade. Dieser Abend hat Sogwirkung, ist ganz großes Theater, eine Sternstunde der Saison.
Virtuoser Schleudergang
Eckhard Weber, Siegessäule
Eckhard Weber, Siegessäule
#KOBEineFrau